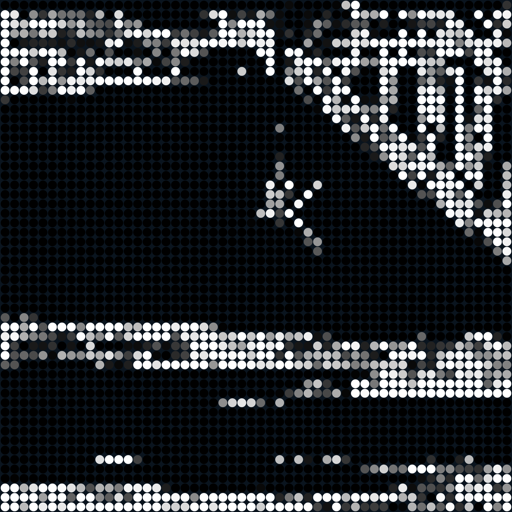escape
Die Flucht
von
Christian Heinke
TECH NOIR
Teil Eins
level null
San Francisco war die letzte Stadt in der Lisa Arnold geglaubt hatte zu sterben.
Blut rann ihr die Stirn hinab ins Auge. Es war ihr Eigenes. Eine Menge davon.
Sie war nackt - und lag gefesselt und geknebelt auf dem schmierigen Boden des Lieferwagens.
Neben ihr lag Phil. Ihr Display war gebrochen und glomm schwach in der Dunkelheit wie Radium.
Lisa war sich nicht sicher, ob sie zu reparieren war.
Egal. Sie waren eh gefickt.
Lisa hörte in der Ferne ein Nebelhorn und das rhythmische Schlagen von Dehnungsfugen im Asphalt.
Sie befanden sich auf einer der Brücken in der Bay. Auf welcher, wusste sie nicht.
Der Wagen stoppte. Jemand auf der Beifahrerseite stieg aus und summte dabei »San Francisco«. Der Jemand öffnete die seitliche Schiebetür des Lieferwagens. Lisa erkannte hinter dem Jemand durch den Nebel hindurch ein rotgestrichenes Geländer:
Golden Gate Bridge.
Der Jemand war Spyder. Lisa hatte ihn so getauft, weil er einen Trainingsanzug dieser Marke trug. Als Lisa Spyder kennengelernt hatte, war der Anzug noch blütenweiß gewesen. Nun war er blutverschmiert. Spyder sah aus wie Liam Gallagher, trug sogar die gleiche verschissene runde Sonnenbrille. Seine Manieren waren dementsprechend.
»Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, Fotze.«
Mit diesen Worten griff er sich Phil. Lisa versuchte zu schreien.
»Genau das ist dein Problem, Fotze. Deine Fixierung auf unnötiges technisches Spielzeug.«
Er hielt Lisa das Mobiltelefon, was so viel mehr war als das, noch einmal vors Gesicht und spielte damit wie mit einer Puppe:
»Sag auf Wiedersehen, Phil.« sagte er mit einer Mädchenstimme.
Dann warf er das Telefon mit einem beachtlichem Wurf über die Brüstung der Brücke. Das Display von Phil leuchtete noch einmal auf wie ein Glühwürmchen, dann wurde es vom Nebel verschluckt.
»NNNNNNNNnnnnnnnnnn!« schrie Lisa. Tränen schossen ihr in die Augen. So ein Ende hatte Phil nicht verdient. Nicht nach allem, was sie gemeinsam durchgemacht hatten. Lisa bäumte sich trotz der Schmerzen auf, drehte sich auf ihrem Hintern, zog die Beine an und trat Spyder mit aller Kraft in den Bauch.
»Uff.« sagte der dazu und fiel hin.
Da traf Lisa eine riesige Pranke am Kopf. Ihr wurde kurz schwarz vor Augen. Als sie wieder da war, spürte sie, wie sie ein zweiter Jemand mühelos hochhob.
Mist. Sie hatte Donkey Kong vergessen. Er hatte die Maße von einem Spyder hoch Drei. In jeder Dimension. Donkey Kong hatte wohl den Transporter gefahren.
Schöne Scheiße.
Etwas riss an Lisas Haaren.
»Das wars, Fotze. Schluss mit lustig.« zischte Spyder ihr zu. Hoffentlich hatte sie ihm ein paar Rippen gebrochen.
Sie wollte ihn trotz des Knebels anspucken, doch da hob sie Donkey Kong schon über seinen riesigen Kopf und schleuderte sie von der Brücke wie einen Sack dreckiger Wäsche.
Ich komme Phil, dachte Lisa noch, als sie durch den Nebel stieß und unter ihr das schwarze Wasser sie erwartete.
Sie waren wirklich gefickt worden.
level eins
Ich saß wie üblich im Quetzal Internet Café in meiner Lieblingsecke, trank einen Triple-Espresso und wartete auf meinen 11 Uhr Termin.
Es war der erste Termin an diesem Tag … Ich brauche meinen Schönheitsschlaf.
Auf Grund meiner Tätigkeit arbeite ich oft bis spät in die Nacht.
Ich studierte den Nachrichten-Feed auf dem iPad, den ich mir selbst aus den unterschiedlichsten Quellen zusammengestellt hatte - zumeist Technologie-Nachrichten. Die Meldung des Tages war natürlich die Hacker-Attacke auf die sweepr.net Internet-Plattform.
Sie haben vermutlich auch ihre virtuellen Leichen dort vergraben, stimmts?
In der vergangenen Nacht war aus dem Bereich der Bay ein so genannter DoS-Angriff auf die Server von sweepr.net erfolgt.
Unbekannte hatten ihre Datenpakete als die von sweepr.net getarnt und in deren Namen an die Rechner von Millionen Usern eine Anfrage gesendet. Brav und dem Internet-Protokoll entsprechend hatten die Rechner der User auf die Anfrage geantwortet. Als Antwortadresse war jedoch nicht die Adresse der Unbekannten eingetragen, sondern eben die von sweepr.net, was dazu geführt hatte, dass die Internet-Plattform durch die millionenfache Bombardierung mit Antworten auf die angeblich legitime Anfrage in die Knie gezwungen worden war.
Der Angriff war so massiv erfolgt, dass es sogar zu einem kurzzeitigen Abschalten der Dienste von sweepr.net geführt hatte. Die Auswirkungen dieses Angriffs hatte ich in der Nacht selbst zu spüren bekommen. Eigentlich hätte ich ein paar Aufträge von Klienten zu erledigen, musste diese jedoch nach der Abschaltung von sweepr.net vertrösten. Es dauerte Stunden bis die Jungs unten in Mountain View wieder alles im Griff hatten. Erst dann konnte ich meine Aufträge abarbeiten, die vertraulichen Daten der Klienten auf sweepr.net sichern und mich anschließend erschöpft schlafen legen.
Ich lehrte meine Tasse, dann tippte ich auf die Twitter-Applikation auf dem berührungsempfindlichen Schirm des iPad. Das kleine Programm öffnete sich und ich aktualisierte mit einem Satz meinen Status:
Sitze im Quetzal Café und warte auf eine Klientin.
Normalerweise pflege ich nicht den Cyberspace über meinen Alltag zu informieren. Meine Privatsphäre ist mir äußerst wichtig. Doch mit Hilfe dieses Tweets, den man einmal ins Internet gestellt auf normalen Wege nur sehr schwer aus dem allwissenden Gedächtnis des weltweiten Computernetzwerkes löschen kann, würde ich meinem 11 Uhr Termin beweisen, wie gut die Algorithmen meines selbstentwickelten Webcrawlers funktionierten.
Mit Hilfe eines solchen autonom operierenden Löschprogamms war es mir möglich den eben verfassten Tweet (wie man diese kurzen Status-Meldungen nannte) aus dem Internet zu tilgen, ohne dabei jedwede Datenspur zu hinterlassen.
Wobei dies natürlich nicht ganz der Wahrheit entspricht. Ein Restrisiko bleibt immer. Doch eine Löschung von 99,99% aller Daten war beachtlich genug und für meine übliche Klientel mehr als ausreichend.
Die Uhrzeit in der Statusleiste des iPad sprang von 10:58 auf 10:59. Ich warf einen Blick durch die großen Fenster nach draußen. Auf der Ecke gegenüber, vor der ›Internationalen Schule für Kosmetik‹ stand eine hochgewachsene, schlanke Blondine. Sie überprüfte den Sitz ihrer Hochsteckfrisur in der Schaufensterscheibe des Instituts. Sie schien zufrieden mit sich zu sein - und das konnte sie auch.
Ich musste schmunzeln. Sie sah ein bisschen aus wie Kim Novak in Vertigo. Sie trug ein hellgraues Kostüm und elegante, teure Schuhe.
Bishop hatte mir immer eingebläut, dass man besonders auf die Schuhe der Klienten achten sollte. »Je teurer die Schuhe, desto liquider der Klient.« pflegte er zu sagen.
Ich war mir ziemlich sicher, dass es sich bei Kim Novak um meine neue Klientin handelte.
Und sie trug teure Schuhe.
Falls sie noch nicht selbst darauf gekommen sind: Ich betreibe eine Identitäten-Agentur.
Ich spüre im Auftrag meiner Klienten deren virtuelle Spuren im Internet auf und modifiziere oder beseitigte diese Spuren - ganz nach Wunsch des Klienten.
Wie sie ja wissen, wird das die Welt umspannende Internet durch soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook immer engmaschiger.
Immer mehr Menschen begannen das Internet zur sozialen Interaktion zu nutzen. Die Datenflut an Informationen steigt dabei ins Unermessliche. Der neue, gefährliche Faktor dieser Entwicklung ist die Verknüpfung der einzelnen Dienste miteinander.
Eine einmal achtlos im Netz hinterlassene Information in Wort, Bild oder Ton kann noch Jahre später auf einer anderen Plattform oder einem Portal wieder auftauchen, mittels weiterer Daten ergänzt und in kaum vorhersehbare und unerwünschte Beziehungen zueinander gebracht werden.
Ein unscharfes Foto von einer betrunkenen Studentin die mit einer Kommilitonin halbnackt herumalbert, konnte Jahre später der inzwischen Anwältin gewordenen Frau den potentiellen Richterposten kosten, da das Foto in Kombination eines Eintrags im Blog der Kommilitonin und den GPS-Daten des Fotos die Anwältin eindeutig identifizierten. Dies war eines der harmloseren Beispiele von unachtsam hinterlassenen Datenspuren.
Zum ihrem Glück hatte die Anwältin jedoch mich mit der Beseitigung der ungeliebten Daten beauftragt.
Mit Hilfe meines fleißigen Webcrawlers dem ich den bescheidenen Namen Excalibur verpasst hatte, tilgte ich erfolgreich die komprimierenden Daten-Spuren aus dem Internet.
Nur wenig später saß meine Klientin auf dem Richterstuhl.
Mein Gespür für den Umgang mit Informationstechnologien habe ich schon recht früh entdeckt. Entsprechend gefördert wurde ich durch meine Mutter, Universitätsprofessorin und Leiterin einer exklusiven Denkfabrik der Regierung. Sie ist eine geborene Reisfeld.
Ja, genau. Sie ist eine von den Reisfelds. Ihr Vater - mein Großvater - war Curt Reisfeld, der so klug war, dass ein Richard Feynman ihn ab und zu um Rat fragte. Nun, meine Mutter ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Doch sie glänzte - wie mein verstorbener Vater - den überwiegenden Teil meiner Kindheit mit Abwesenheit. Daher blieb mir viel Zeit, die ich nur zu gern vor dem Computerbildschirm verbrachte.
Ich stellte fest, das Computer im Gegensatz zu Menschen ihre Versprechungen immer einhielten. Statt mit Puppen zu spielen, programmierte ich daher schon mit vier Jahren kleine Oden an meine Mutter in BASIC:
10 PRINT »FUCK U, MOM!«
20 GOTO 10
(Zur Erklärung meiner Wortwahl: Wenn man in dem Alter bereits mit einem BASIC Interpreter umgehen kann, dann stellen die Kinderschutz-Einstellungen einer Set-Top-Box für das Kabelfernsehen keinerlei Herausforderung dar.)
Doch irgendwann geht auch die glücklichste, verdorbene Kinderzeit vorbei und ich musste mich der harten, kalten Realität stellen: Ich war nicht der einzige bindungsgestörte Nerd im Silicon Valley.
Einer meiner engsten Freunde war ein Junge mit Namen Rich. Nomen war in diesem Fall im übrigen kein Omen - Richs Eltern waren für Silicon Valley Verhältnisse bettelarm. Doch er war fast so schlau wie ich und hatte eine grandiose Idee: Er wollte ein Internet im Internet bauen. Eine sichere, geschlossene Wohnanlage für Geheimnisse, die im Gegensatz zu Facebook, Myspace und dem ganzen Rest des Internets nicht die Daten von Usern ausspähte, sondern diese mit Klauen und Zähnen verteidigte.
Es gab nur ein kleines Problem. Rich war ein guter Kommunikator, aber ein ziemlich lausiger Code Monkey.
Doch er hatte ja mich. Wir schlossen einen Pakt. Ich half ihm, den Code für seine geschlossene, virtuelle Wohnanlage zu schreiben und er gab mir dafür Anteile an dem Aktienvermögen, dass wir mit seiner Idee irgendwann gemeinsam zu erwirtschaften hofften.
Richard war Fußball-Fan und so taufte er sein geistiges Kind ›sweepr.net‹ - nach den aus der Mode gekommenen Ausputzern in der Abwehr.
Ja, sie haben richtig gehört. Sweepr-Fucking-Dot-Net. Ich bin Gründungsmitglied Nummer Zwei von einer der erfolgreichsten Internetfirmen aller Zeiten.
Rich, den sie wohl eher als Richard Baxter kennen, wurde mit sweepr.net superreich und superberühmt. Mich hingegen kennt man eigentlich nur als diejenige, die dem superreichen, superberühmten Richard Baxter an die Gurgel gesprungen ist.
»Was soll das?« fragte ich und starrte auf das Blatt Papier vor mir. Auf dem blitzblanken Glastisch schien es in der Luft zu schweben.
Der Anwalt legte einen Stift auf das Blatt Papier. Es war ein goldener Kugelschreiber. Seine Spitze zeigte auf eine Linie auf dem Blatt unter der ganz klein mein Name stand.
»Wir sind der Ansicht das eine Neubewertung ihrer Position in der Struktur von sweepr.net …« begann der schmierige Anwalt.
»Ich habe nicht sie gefragt.« fuhr ich ihn an. »Rich, was soll das?«
Rich saß neben Mr. Rechtsverdreher. Beide saßen mir in dem klinisch reinem Konferenzraum gegenüber. Rich trug wie der Anwalt einen Anzug.
Einen Anzug! Unglaublich. So war Rich früher nicht rumgelaufen. Er trug keine Flip-Flops wie Mark Zuckerberg. Meistens lief er Barfuß herum. Ich warf einen flüchtigen Blick auf seine Füße. Sie waren in teures italienisches Leder gehüllt. Seit er dieses Supermodel Katherine Williams kennengelernt hatte, war Rich nicht mehr derselbe. Der Yoko-Ono-Effekt hatte bei ihm eingesetzt. Es musste so sein. Anders konnte ich mir dieses Scheißdokument vor mir auf dem Tisch nicht erklären.
Schade, dachte ich. Wir waren eine so gute Band gewesen.
»Du bist einfach kein Teamspieler, Peewee.« sagte Rich kühl.
Ich hielt den Kopf schief und sah Rich in die Augen.
»Obwohl ich lesbisch bin, fühle ich mich von dir gerade richtig in den Arsch gefickt, Rich.«
Der Anwalt verzog das Gesicht und hob abwehrend die Hände. »Bitte, Miss Russell, seien wir doch alle …«
»Klappe, Anwalt.« sagte ich scharf. »Peewee. Unterschreib einfach. Wenn du es nicht tust, dann bekommst du gar nichts.«
»Wir hatten einen verfickten Pakt, Rich!« schrie ich ihn an.
»Wir sitzen nicht mehr zu Dritt in meiner Garage, Peewee.« erwiderte er. »Wir sind jetzt ein globales, ständig expandierendes Unternehmen. Verdammt, wenn wir so weiter wachsen werden wir in drei Monaten wahrscheinlich größer als Google sein!«
»Wie schön für dich, Rich.« Er seufzte.
»Womit wir wieder beim Ausgangspunkt unseres Gespräches sind, Peewee. Alles muss immer nach deinem Kopf gehen. Katherine sagt auch, dass …«
Weiter kam er nicht. Ich weiss nicht warum die Erwähnung von Katherine ›Die Göttin‹ Williams mich so in Rage versetzte. Vielleicht lag es daran, dass Rich offenbar Tisch und Bett miteinander verband, indem er Katherine in den Kreis seiner Berater mit einbezog.
Wie auch immer. Ich sprang auf und stürzte mich auf ihn. Der Anwalt wollte mich aufhalten. Daraufhin trieb ich dem Arsch seinen goldenen Kugelschreiber in den Handrücken.
Dann wandte ich mich Rich zu. Ich glaube kaum, dass ich die Kraft dazu gehabt hätte ihn zu erwürgen.
Der Richter sah das leider anders.
Verhaftung. Fristlose Kündigung. Anklage wegen schwerer Körperverletzung. Astronomische Anwaltskosten. Ein Vergleich der mich vor dem Gefängnis bewahrte. Sozialstunden. Aufsammeln von Müll am Straßenrand.
Zum Schluss bekam ich eine lächerliche Abfindung, die zusammen mit meinen Ersparnissen gerade so meine Ausgaben deckte.
Vielleicht hätte ich doch das Scheißpapier unterzeichnen sollen.
Niemand im Valley wollte mich nach dem Vorfall mit Baxter mehr einstellen. Die IT-Welt war ein Dorf. Schon einen Tag nach dem Vorfall galt ich im Netz als gemeingefährliche Coding-Diva und Querulantin. Gerüchte-Blogs wie der berühmt-berüchtigte Valleywag gaben mir den Rest.
Eine so tiefe Datenspur konnte nicht mal mein Weltklasse-Webcrawler verwischen.
Eine zeitlang lebte ich sprichwörtlich von der Hand in den Mund. Ich war zu stolz um mich mit meinen Problemen an jemanden zu wenden.
Erst als ich den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, besserte sich meine Situation. Im Grunde hatte ich gar keine andere Wahl. Also machte ich aus der Not eine Tugend und gründete die Identitäten-Agentur Wega5.
Der Name stammt aus einer Wahnvorstellungen meiner mittlerweile vollkommen verrückt gewordenen Mutter.
Schnell baute ich mir einen kleinen Kundenstamm auf - überwiegend Menschen die wie ich nichts zu verlieren hatten - und nach ein paar Monaten war ich ganz gut im Geschäft. Fast jeder der Digital Natives im Valley hatte ein, oder zwei virtuelle Leichen im Keller, von denen er wünschte, sie würden sich in Luft auflösen. Und mit meinem magischen Schwert, geschmiedet aus komplexen Codezeilen war ich gern bereit zu helfen - nach Zahlung einer kleinen Aufwandsentschädigung natürlich.
Die attraktive Frau mit den teuren Schuhen betrat das Café und sah sich um. Sie entdeckte mich, lächelte mir zu und kam auf direktem Wege zu meinem Tisch.
Touchdown. Frenetischer Jubel der Menge, dachte ich.
»Miss Russell?« fragte die Frau. »Höchstselbst.« antwortete ich. »Und sie sind?«
»Richtig. Ich hatte mich in meiner Email noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich heiße Rachel. Rachel Garrett.« Sie hielt mir ihre schmale Hand mit perfekt lackierten Fingernägeln hin. Ich schüttelte sie mit meinen abgekauten Krallen. Der Händedruck der Frau war sanft und trocken.
»Es freut mich das Sie Zeit für mich finden konnten, Miss Russell. Darf ich?« Sie deutete auf den Stuhl gegenüber.
»Natürlich.« antwortete ich. Rachel nickte, setzte sich mit beachtlicher Anmut und lächelte mich mit ihrem perfekt geschminktem Gesicht freundlich an. Ich bedauerte nun irgendwie die eigene Morgentoilette auf ein Minimum beschränkt zu haben, nur um noch ein paar Minuten mehr Schlaf zu bekommen. Ich räusperte sich.
»Nun, was kann die Agentur Wega5 für Sie tun, Miss Garrett?«
Rachel lachte. Es war klares, freundliches Lachen. Ich hob überrascht die Brauen.
»Warum lachen Sie?«
»Bitte verzeihen Sie, Miss Russell. Ich glaube ich hatte einfach eine zu romantische Vorstellung von einer Identitäten-Agentur. Zu viele Filme der Schwarzen Serie vermute ich. Ich hatte nicht erwartet, dass wir uns so konspirativ in einem Internet Café treffen.«
Nein, dachte ich. Das ist nicht der Grund. Ich war gut darin Gesten und Mimik eines Menschen zu interpretieren. Rachel log. Ich beschloss diese Erkenntnis zunächst für mich zu behalten.
»Alles was ein guter Agent heutzutage braucht ist ein Zugang zum Internet und ein wenig Erfahrung im Data-Mining. Das ist schon der ganze Zauber.« erklärte ich.
»Ich glaube, Sie stellen Ihr Licht unter den Scheffel, Miss Russell. Ich habe ein paar Erkundigungen in der Szene eingeholt. Die einstimmige Meinung ist, dass Sie die Beste sind, wenn man unangenehme Wahrheiten aus dem Internet tilgen möchte.«
»Ist das so?« fragte ich unschuldig. Doch mir stellten sich die Nackenhaare auf. Erkundigungen. Das war nicht die Sprache einer Frau, die ein paar Tweets mit ihrer Affäre aus dem Netz löschen wollte.
»Mit wem haben sie denn gesprochen, als sie ihre Erkundigungen eingeholt haben?«
Rachel rückte ein wenig näher.
»Nun, Martin Bishop zum Beispiel hat Sie in den höchsten Tönen gelobt.«
Ich hielt den Kopf schräg und schwieg. Dann nickte ich stumm.
Die Karten lagen auf dem Tisch.
Ich packte das iPad in meine Crumpler-Tasche, stand auf, legte mir den Tragriemen der Tasche über die Schulter und reichte zum Abschied Rachel die Hand.
»Hat mich gefreut, Miss Garrett.« sagte ich.
»Was soll das?« fragte diese. Ihre Mienenspiel war von echter Verblüffung kaum zu unterscheiden.
Ich zuckte nur mit den Schultern.
»Ich arbeite nicht für die Feds. Aus Prinzip.«
Kim Novak/Rachel starrte mich einen Augenblick lang an. Dann seufzte sie wie jemand der aus einem unbequemen Paar Schuhe stieg. Plötzlich änderte sich ihre Haltung und ihre Gesichtsausdruck nahm eine professionelle Ernsthaftigkeit an. Ihre offenbar echte Identität einer Regierungsbeamtin kam nun zum Vorschein. Sie zückte einen Dienstausweis. Darauf stand kein Name, nur ein Akronym ... oder genauer: Ein Apronym.
»R.E.A.C.T?« las ich laut und hob die Brauen. »Das ist witzig. Warum nennt ihr euch nicht gleich S.H.I.E.L.D?«
»Ich vermute die Lizenzgebühren an Marvel Comics waren dem Staat Kalifornien zu hoch.« antwortete die Frau, ohne eine Miene zu verziehen. Ich schüttelte bedauernd den Kopf.
»Schön, klug und doch bei den Sturmtruppen.« Ich tippte mir an eine imaginäre Hutkrempe. Haben Sie noch einen schönen Tag.«
Die Regierungsbeamtin stellte sich mir in den Weg.
»R.E.A.C.T. steht für Rapid Enforcement Allied Computer Team. Ich kann ihnen versichern, Miss Russell - Wir sind die Guten. Mein Boss möchte sich nur mit ihnen unterhalten.«
Martin Bishop hatte mir mal geraten Menschen nicht zu vertrauen, die von sich behaupteten ›Die Guten‹ zu sein. Plötzlich hörte man das Knattern eines sich nähernden Hubschraubers.
»Oh.« bemerkte ich. »Die Guten reisen neuerdings in schwarzen Helikoptern?«
Rachel lächelte. »Ihre Paranoia bezüglich Autoritäten ist ja noch schlimmer als in ihrer Akte angegeben.«
»Ich habe eine Akte?!« fragte ich.
Rachel seufzte. Eine Haarsträhne hatte sich aus ihrem Haararrangement gelöst. Sie strich sie zurück und musterte mich wie eine geduldige Grundschullehrerin. »Natürlich haben sie eine Akte. In einem Punkt haben Sie recht. Dieser Hubschrauber ist unser Transport. Er wird uns auf dem Dach dieses Gebäudes aufnehmen.« Sie bugsierte mich sanft aber bestimmt in Richtung des Lastenaufzugs im hinteren Teil des Cafés.
»Warum ich?« erkundigte ich mich, als der Aufzug schwerfällig nach oben kletterte.
»Wie ich schon sagte, Miss Russell ... Sie wurden uns empfohlen.«
Als wir das Parkdeck auf dem Dach erreichten, war der Hubschrauber bereits gelandet. Es war ein Bell 206 und trug das Emblem der California Highway Patrol. Diese Tatsache trug nicht besonders zu meiner Beruhigung bei.
»Worauf warten sie? Steigen sie schon ein!« rief Rachel vor der imposanten Geräuschkulisse der Rotoren und wies auf die geöffnete Seitentür. Wiederwillig kletterte ich in das Innere.
Hinter dem Piloten gab es vier Sitzplätze. Rachel und ich nahmen auf den Sitzen direkt hinter dem Piloten platz. Uns gegenüber saßen zwei Männer. Einer war offenbar ebenfalls Regierungsbeamter und trug ein schwarzen Anzug. Der andere Mann war älter. Er hatte das graue Haar zu einem Zopf gebunden, hatte einen Vollbart und trug einen blaues Baumwollhemd, altmodische Khakihosen und Handschellen.
»Hallo Kleines« begrüßte der Mann mich mit einem schiefen Lächeln.
Ich brauchte einen Augenblick um die Tragweite der Situation zu erfassen.
»Hallo.« erwiderte ich dann knapp. Der Mann war Martin Bishop.
Der Hubschrauber erhob sich elegant vom Parkdeck, stieg auf und flog dann in Richtung Süden, was mir logisch erschien. Soweit ich mich erinnerte, operierte die R.E.A.C.T. Task Force aus dem Silicon Valley heraus. Das Ziel ihrer Reise lag also vermutlich in Cupertino oder Campbell.
Ich musterte Bishop, den alten doppelzüngigen Mistkerl, der mich offenbar an die Behörden verpfiffen hatte. Dieser hielt meinem Blick stand. Er lächelte. »Schön dich wiederzusehen, Kleines.«
»Fahr zur Hölle!« zischte ich. Der Mann im Anzug, der neben Bishop saß musste grinsen. Bishop lächelte nicht mehr. Er sah mich sorgenvoll an und beugte sich vor. Der Mann neben ihm berührte ihn am Arm und schüttelte den Kopf. Bishop seufzte und lehnte sich wieder zurück. Nun musste er lauter sprechen:
»Ich habe ihnen nichts erzählt, Kleines. Sie wussten bereits alles über dich, was es zu wissen gab.« Ich ignorierte ihn, verschränkte die Arme übereinander und studierte die Ameisenpfade der Highways unter uns.
»Was wollen die von uns, Bishop?« fragte ich nach einer angemessenen Zeit des Schmollens.
»Sie werden es zu gegebener Zeit erfahren.« erwiderte Rachel, bevor Bishop etwas erwidern konnte. Sie zückte ein Mobiltelefon, welches ich anhand der Größe als ein abhörsicheres Satellitentelefon identifizierte.
»Garrett hier. Nummer Drei haben wir ebenfalls. Wir fliegen jetzt zurück … Gut … ETA 23 Minuten.« Sie beendete das Gespräch und nickte dem Mann im Anzug zu: »Nummer Eins ist schon von Ort.«
»Gut.« erwiderte der Mann im Anzug.
Ich musste schmunzeln. Der Mann im Anzug sah fragend mich an.
»Was ist so witzig?!«
»Was wollt ihr Typen von Rhyzkov, Bishop und mir?«
»Wie kommen sie darauf …« begann der Mann im Anzug. Ich unterbrach ihn.
»Einfache Deduktion. Ich bin Nummer Drei und ›ebenfalls an Bord‹. Martin ist der zweitbeste Hacker der Welt, also ›Nummer Zwei‹. Und Sergej Rhyzkov ist bekanntermaßen die Nummer Eins.«
Martin Bishop grinste und schüttelte bewundernd den Kopf. »Ich habe ihnen gesagt, sie ist die Beste.«
»Ich hoffe sehr, dass sie damit recht haben, Mr. Bishop.« sagte Rachel Garett ruhig. Der besorgte Ton in ihrer Stimme ließ Bishop verstummen.
»In unser aller Interesse hoffe ich wirklich, dass sie recht haben.«
Neun Stunden zuvor.
Aus den übergroßen Boxen der Boombox dröhnte Soulja Boys Turn My Swag On. Sie hatten die Wagen am Parkplatz abgestellt und waren runter zum Strand gewandert, hatten Holz gesammelt, ein Feuer gemacht und dabei in aller Ruhe einen Joint geraucht. Die Cops kontrollierten hier in Kirby Cove relativ selten, ebenso die Park Ranger. Der Platz war eigentlich perfekt. Nur die Waschbären nervten.
Sie lungerten in einiger Entfernung im Unterholz. Ihre neugierigen Augen glühten im Schein des Feuers wie die von Jawas in den Star Wars Filmen.
»Hey, Mann.« sagte eines der Mädchen zu Morrison. Malcom konnte sich wegen der Dröhnung nicht an den Namen des Mädchens erinnern. Aber sie hatte einen geilen Arsch - und schliesslich war es das, was zählte.
»Häh?« fragte Morrison, der viel zu beschäftigt war die linke Brust des Mädchen zu kneten, als wäre sie aus Brotteig.« Das Mädchen zog Morrisons Hand aus ihrem T-Shirt und drehte seinen Kopf in Richtung ihrer märchenhaften Entdeckung.
»Da liegt ne Meerjungfrau, Mann.«
»Häh?« fragte Morrison, der nur verwirrt seine Hand betrachtete. Sie führte immer noch knetende Bewegungen aus.
»Da …« sie deutete mit ihren langen Fingern ein Stück den Strand runter.
»Wenn ichs doch sage. Da liegt ne Meerjungfrau am Strand.«
»Was erzählst du denn hier für ne verschissene Scheiße? Meerjungfrauen gibt es nicht. Das ist sonne verschissene Disney Propaganda-Scheiße.«
Wenn Malcom zuviel rauchte, neigte er zu Fäkalsprache. Dennoch blickte er in die Richtung in der das Mädchen gezeigt hatte.
Tatsächlich. Da lag etwas am Strand.
Finsternis.
Finsternis und Sand.
Finsternis, Sand und das sanfte Schlagen der Wellen.
Das war es also? Das war der Tod.
Nein.
Das hier war nicht der Tod.
Das hier … war einfach nur … ein … Strand.
Sie lag auf einem Strand. Salziges Wasser umspülte ihre Beine. Ihre Arme waren über ihren Kopf gestreckt und immer noch mit dem Kabelbinder gefesselt.
Sie erinnerte sich nur bruchstückhaft:
Der Sturz hatte vielleicht fünf, sechs Sekunden gedauert. Noch in der Luft hatte sie die Beine angezogen, war durch ihre Arme gestiegen und war gestreckt ins Wasser eingetaucht. Das von ihr ungeliebte Turmspringen in der Ravenwood Privatschule hatte sich also doch einmal als nützlich erwiesen.
Dennoch fühlte es sich an, als hätte Sie einen Schraubensalto in ein leeres Becken vollzogen. Vom Aufprall benommen, versank sie sekundenlang in der eiskalten Finsternis. Dann ging ihr die Luft aus und sie strampelte sich wieder an die Oberfläche. Sie sog die kalte Luft ein und versuchte in Richtung Ufer zu schwimmen.
Nach ein paar Minuten, die ihr wie Stunden vorkamen spürte sie, wie ihre Kraft schwand und dann … ja … was war dann geschehen?
Finsternis.
Kalte Finsternis hatte sie umfangen und ihren Mund und ihre Lungen gefüllt.
Und nun … lag sie hier am Strand … und war am Leben.
Finsternis macht kein Ende mit mir, und das Dunkel will vor mir nicht verdeckt werden.
Sie hatte Keiko damals ins Gesicht gelacht, als sie wie üblich die Bibel zitiert hatte. Doch die verfickte Reisfresserin hatte recht behalten. Sie hatte Lisa besser gekannt, als sie sich selbst.
Finsternis macht kein Ende mit mir.
(Erkennst du nun endlich an, was du bist, Tochter?)
Nein. Das konnte nicht sein.
Doch welche andere Erklärung gab es für die Tatsache, dass sie noch lebte?
Ein menschliches Wesen hätte die Folter und die Vergewaltigung überstanden. Vielleicht auch noch den Sturz von der Golden Gate Bridge überlebt, wenn auch schwer verletzt.
Doch das Wasser ...Wie hatte sie das schwarze, kalte Wasser überlebt?
So kalt.
(Du kennst die Antwort. Akzeptiere deine Bestimmung.)
Halte dein blödes Maul, Mutter. Ich muss nachdenken.
Das Dunkel will vor mir nicht verdeckt werden.
Konnte es sein? Durfte es sein, dass ihre manipulierende durchgedrehte Bestie von Mutter all die Jahre doch recht gehabt hatte? Das sie nicht eine verrückte religiöse Eiferin war, sondern einfach nur das, was sie immer und immer wieder gepredigt hatte?
(Erkenne, was du bist, Tochter.)
Oh, Gott, dachte Lisa.
Ja, Mutter. Ich erkenne, was ich bin.
Etwas hartes wurde Lisa in die Seite gedrückt. Es war nicht kalt. Kein Metall.
Holz. Ein Baseballschläger.
»Scheiße. Die ist hin.« sagte eine Stimme.
»Echt? Meinst du?« fragte eine zweite Stimme.
Eine Pause.
»Und wenn nich?«
Was nun folgte, war die Verkettung unglücklichen Verhaltens auf beiden Seiten. Malcom, der vor den Mädchen nicht als Angsthase dastehen wollte, schlug mit dem Baseballschläger ein wenig fester in Lisas Seite, als ursprünglich von ihm intendiert. Lisa wiederum stufte diesen Schlag als Bedrohung ein. Sie rollte sich plötzlich zur Seite und hielt den Holzschläger mit beiden Händen fest.
»Hey, lass meinen Knüppel los!« beschwerte sich der verblüffte Malcom. Die Mädchen mussten kichern. Malcoms Überraschung wuchs, als Lisa ihm den Schläger ihm mit einer blitzschnellen Bewegung entriss. Dann schleuderte sie das Holz in die Luft. Nach einer zweieinhalbfachen Drehung landete das Griffende des Baseballschlägers in ihren immer noch gefesselten Händen.
»Was fürne verfickte …« sagte Malcom noch, dann stieß Lisa das breite Ende des Schlägers so heftig ins Malcolms Gesicht dass Splitter seines Nasenbeins in sein Gehirn eindrangen. Malcoms Knie klappten zusammen wie eine Strandliege und er war bereits tot, als er mit dem Gesicht voran in den Sand stürzte.
Die Mädchen schrien auf. Morrison, vollkommen stoned, wieherte wie ein Pferd.
»Voll cool. Voll auf die Zwölf!«
Ich weiß jetzt, was ich bin, dachte Lisa und stand langsam auf. Sie riss den Kabelbinder der ihre Hände fesselte so leicht auseinander, als wäre er aus Papier. Dann nahm sie den Baseballschläger und ging auf den immer noch lachenden Morrison zu. Im Mondlicht erinnerte Lisa mit ihrer nackten Haut und ihr nassem Haar an Botticellis Geburt der Venus. Nur der Baseballschläger in ihrer Hand störte das Bild.
Morrisons Lachen endete abrupt als Lisa es ihm aus dem Gesicht schlug. Seine vorderen Zähne beschrieben einen Bogen und leuchteten im Schein des Feuers kurz auf wie Sternschnuppen - dann waren sie im Dunkel verschwunden.
Jetzt rannten die Mädchen los. Sie wussten, es ging um ihr Leben.
Die erste erwischte Lisa recht schnell. Sie packte das Mädchen bei den Haaren, umfasste sie mit der anderen Hand von hinten und brach ihr mit einer schnellen Bewegung das Genick.
Das zweite Mädchen schaffte es bis zu den Wagen. Sie öffnete gerade die Tür des Mustangs, als sie der von Lisa geworfene Baseballschläger am Kopf traf. Sie taumelte, blieb jedoch auf den Beinen, da sie sich instinktiv an Tür und Motorhaube festklammerte.
Dann war Lisa bei ihr.
»Bitte.« flehte sie wimmernd. »Tu mir nichts!«
Lisa umfasste ihren Kopf mit den Händen. Sie wollte etwas sagen, doch da fiel ihr auf, dass ihre Lungen immer noch voll Wasser waren. Sie würgte und spie dem Mädchen brackiges Seewasser entgegen.
Das Mädchen verzog angewidert das Gesicht.
»Noch gestern« begann Lisa krächzend zu sprechen. »hätte ich dir kein Haar gekrümmt.«
Es wäre eine humane Geste gewesen, dem Mädchen nichts zu tun.
Doch leider wusste sie nun, was sie wirklich war …
Finsternis macht kein Ende mit mir, und das Dunkel will vor mir nicht verdeckt werden.
»Pech für dich.« sagte Lisa und drückte ihre Daumen tief in die Augenhöhlen des Mädchens. Das Mädchen schrie. Lisa drückte ihre Daumen tiefer hinein und der Schrei des Mädchens endete abrupt. Sie brach zusammen wie Marionette, deren Fäden zerschnitten waren.
»Wirklich, Pech.« murmelte Lisa und begann in aller Ruhe das Mädchen zu entkleiden.
level zwei
Neuneinhalb Stunden später.
Ich sah hinab auf die dahingleitenden Legosteine, zwischen denen winzige Ameisen in Reih und Glied entlang krabbelten.
Der Helikopter begann seinen Sinkflug und aus den Legosteinen wurden Gebäude und aus den Ameisen wurden Autos auf dem Highway.
Als der Helikopter auf dem Dach des Gebäudes aufsetzte in dem R.E.A.C.T. seinen Sitz hatte, wurden wir bereits von einem Trupp bewaffneter Männer in Kampfanzügen erwartet.
Ich musste an Kevin Mitnick denken.
In den 90ern war Mitnick einer der gefürchtetsten Hacker des Landes. Das F.B.I. ließ ihn nicht einmal in die Nähe eines Münzfernsprechers, weil die sogenannten Regierungsexperten davon überzeugt waren, dass er die Nummer einer Raketenabschussbasis anrufen könnte und allein mit Hilfe seiner Stimme Pfeiftöne zu erzeugen vermochte, die die dort stationierten Marschflugkörper zum Abschuss brächten.
Was natürlich vollkommener Bullshit war.
Doch diese Anekdote war ein schönes Beispiel der Paranoia die bei den Feds angesichts eines Hackers herrschten.
»Schön, wenn einem die Regierung mal zeigt, was sie von einem hält.« murmelte Bishop angesichts des schwer bewaffneten Empfangskommitees.
»Diese Männer dienen alleinig zu ihrem und Miss Russells Schutz.« erklärte Agentin Garrett.
Ich wollte gerade zu einer spitzen Bemerkung ansetzen, verkniff es mir aber wieder, als ich bemerkte, dass die Männer einen schützenden Kreis um Bishop und mich bildeten. Sie sicherten uns von allen Seiten ab und hielten sogar im Himmel über uns nach möglichen Angreifern Ausschau.
»Bitte beeilen sie sich. Hier draußen ist es nicht sicher.« mahnte Agent Garrett.
Der Tross der Beamten schob uns in Richtung einer schwer gesicherten Tür. Rachel legte ihre rechte Handfläche auf eine Metallplatte an der rechten Seite des Türrahmens. Im Anschluss daran zeigte Rachel der Metallplatte noch ihr Gesicht.
Handscanner und Gesichtserkennung, dachte ich. Die meinen das hier echt ernst. Ich stieß Bishop in die Rippen.
»Was zum Teufel hast du dieses mal angestellt, Bishop?« flüsterte ich ihm zu.
»Ich schwöre dir Kleines, ich bin seit Jahren nicht mehr aktiv. Ich dachte, die veranstalten den Zirkus wegen dir.«
Ein grünes Licht zeigte an, dass Rachel von dem elektronischen Torwächter als würdig eingestuft wurde. Die gepanzerte Tür schob sich zur Seite und gab den Blick auf einen Aufzugskabine frei.
»Los, rein mit ihnen. Schnell!« befahl Rachel. Die Beamten schoben uns so schnell hinein, dass unsere Füße kaum den Boden berührten.
Der Aufzug beförderte uns vom Dach in einen gesichtslosen langen Gang mit grauem Teppich und vielen Türen Links und Rechts an denen weder Türschilder noch Nummern zu finden waren. Der Gang mündete in einen Konferenzraum von dem zwei Seiten aus Fenstern bestanden, die jedoch kein Licht hinein liessen, da die stählernen Jalousien heruntergelassen waren.
Im Raum erwartete uns ein lang gestreckter Tisch mit etwa ein dutzend Stühlen.
Am Kopfende des Tisches stand eine Frau in einem geschmackvollem Kostüm. Vom Aussehen her spielte sie in derselben nordischen Liga wie Rachel, nur das die Frau ein wenig älter war und eine modische Brille trug.
Zur rechten der Frau saß ein Junge, nicht älter als 14 Jahre.
Der Logik folgend musste das Rhyzkov sein. Flankiert wurde der Junge von zwei grimmig drein blickenden Männern im Anzug.
Wieder musste ich an Mitnick denken:
Sollten wir Hacker fürchten? Die Absicht des Hackers liegt im Herzen dieser Diskussion.
»Guten Tag, Miss Russell, Mr. Bishop. Mein Name ist Samantha Risk ich bin Deputy District Attorney und derzeitige Leiterin von R.E.A.C.T.. Es freut mich in ihrem Interesse, dass sie die Zeit für diese informelle Zusammenkunft finden konnten.« sagte die Frau mit einer angenehm rauen Stimme.
»Pah!« gab Bishop von sich und ließ sich auf einen der Stühle plumpsen.
Die Frau blickte auf die Handschellen von Bishop.
»Was soll das?« fragte die Frau Agent Garrett und den Mann im Anzug.
»Mr. Bishop leistete bei seiner ... bei der freiwilligen Kooperation Widerstand.«
»Sprecht ihr Faschisten hier eigentlich alle dieses Neusprech?« feixte Bishop. »Ihr verdammter Nazi hier hat meine Frau bedroht, als ihr mich abgeholt habt.«
»Ist das wahr?« fragte die Frau am Tischende scharf.
Der Mann im Anzug senkte die Schultern. »Miss Bishop hat sich tätlich gegen die Mitnahme ihres Mannes zur Wehr gesetzt. Sie hat mehrere Gegenstände nach mir geworfen. Ich war gezwungen ihr mit Vergeltungsmaßnahmen zu drohen. Das ist alles.«
»Ich danke ihnen, Agent Mitchell. Sie haben gute Arbeit geleistet. Sie können nun Mr. Bishop die Handschellen abnehmen.« Die Frau wandte sich an Bishop.
»Mr. Bishop. Diese Behandlung von ihnen und ihrer Frau tut mir aufrichtig leid. Leider konnten wir sie aus Gründen der Geheimhaltung nicht vor Ort von der Dringlichkeit ihres Kommens in Kenntnis setzen.«
»Entschuldigung nicht akzeptiert.« sagte Bishop, rieb sich die Handgelenke und verschränkte dann die Arme über der Brust.
Rhyzkov, der Junge, sagte etwas zu der Staatsanwältin Risk auf Russisch. Zu Peewees Überraschung antwortete die Staatsanwältin dem Jungen ebenfalls auf Russisch.
Bishop, deren Frau aus Russland stammte, konnte der Konversation offensichtlich auch folgen:
»Ich finde die Frage des Jungen durchaus berechtigt, Miss Risk. Er ist der Beste. Wozu brauchen Sie da einen alten Sack wie mich oder jemanden wie Peewee? Sie ist seit Jahren nicht mehr als Hackerin aktiv …« Er wandte sich an Peewee. »Oder doch, Kleines?«
Ich antwortete nicht. Ich war nicht mehr besonders wütend auf Bishop. Offenbar hatten die Feds ihm wirklich keine Wahl gelassen. Die arme Liz - Dennoch … Irgendwie hatte ich mehr von Bishop erwartet.
»Meine Aktivitäten zumindest liegen mittlerweile Jahrzehnte zurück, Mam.« erklärte dieser der Staatsanwältin.
»Ich habe die Berichte über ihre letzten ›Aktivitäten‹ gelesen, Mr. Bishop. Sie haben Anfang der Neunziger Jahre für einige Zeit die Gelder der Republikanischen Partei auf Konten von Greenpeace und anderen wohltätigen Organisation transferiert.«
»Darunter war auch United Negro College Fund.« entgegnete Bishop lächelnd. »Leider nicht die White Power Bewegung. Ansonsten stünden die Chancen bestimmt gut, dass mein kleiner Hack Sie durchs College gebracht hätte.« Die Augen hinter den Brillengläsern von Staatsanwältin Risk wurden schmal.
»Fast witzig, Mr. Bishop.« Sie machte ein Pause. Bishop sah auf seine Hände und schwieg. Er wusste, dass er damit ein wenig zu weit gegangen war. »Zudem …« fuhr Risk fort. »… kursiert in Washington das Gerücht, dass Sie im geheimen aktiv Internetseiten wie WikiLeaks unterstützen.«
»Pah!« sagte Bishop. »Also ich bin heute Morgen noch in einem freien Land aufgestanden. Es geht Sie und Ihren Spießgesellen einen Scheißdreck an, wen ich unterstütze und wen nicht - solange Sie mir nicht nachweisen können, dass ich gegen das Gesetz verstoßen habe. Das ist nämlich der Scheißhaken an der Demokratie: Was für Ihre schleimigen Wallstreet-Freunde gilt, gilt auch für mich, Lady.«
»Wie dem auch sei, Mr. Bishop. Zahlreiche republikanische Senatoren in Washington fordern ihren Kopf, obwohl oder auch vielleicht gerade weil Ihnen nie illegale Aktivitäten nachgewiesen werden konnten.«
Bishop zuckte gleichgültig mit den Achseln.
»All das beweist mir, dass sie keinesfalls zum alten Eisen gehören. Mr. Bishop. Was Miss Russell hier angeht …« Sie wies mit einer Handbewegung auf Peewee, »… so sind ihre umfangreichen Kenntnisse um die Algorithmen von sweepr.net, was sie wohl zu einem lohnenden Ziel gemacht hat.«
Ich war bei dem ›Wer pisst höher‹-Spiel zwischen der Staatsanwältin und Bishop gedanklich ausgestiegen.
»Was haben sie gerade gesagt?« fragte ich daher nach.
Der Mann, den Lisa Arnold auf Grund seiner Kleiderwahl Spyder getauft hatte, saß im Golden Gate Park auf einer der Bänke und begutachtete breit grinsend die vorbei laufenden Mädchen. Dabei kaute er so lautstark auf einem Kaugummi herum, dass sein kolossaler Freund neben ihm, den Lisa Arnold Donkey Kong nannte, nicht gleich verstand, als Spyder diesen etwas fragte.
»Ich sagte, ich hasse dieses neumodische Spielzeug.« Er deutete auf das BlackBerry PlayBook welches zwischen den riesigen Pranken des Koloss wie eine glänzende Tafel Schokolade wirkte.
»Achso«, sagte Donkey Kong. Kongs richtiger Name war Ronald. Spyders richtigen Namen kannte Ronald nicht. Er wollte, dass Ronald ihn Lacey nannte. Auf die Frage warum, hatte dieser geantwortet: »Na wegen Raiders.« Ronald wusste nicht genau was Lacey damit meinte und es interessierte ihn auch eigentlich nicht. Ihn interessierten nur seine Konstruktionen, die Lacey in seiner Unwissenheit als ›neumodisches Spielzeug‹ abtat. Dabei waren es Kunstwerke. Das hatte ›Mutter‹ auch gesagt.
Ronald gab die letzten Korrekturen in das Steuerungsprogramm ein. Dann startete er es indem er eine Taste drückte und sah vom PlayBook hoch. »Bereit.« sagte er.
Lacey nickte: »Let's Roll.«
Ronald tippte eine weitere Taste. In der unteren linken Ecke des Bildschirms erschien das Livebild einer Webcam. Es zeigte das Innere eines Lieferwagens. Er ähnelte dem Fahrzeug, welches sie für den Transport von Lisa Arnold verwendet hatten. Natürlich war es nicht derselbe. Den alten Lieferwagen hatten sie bereits abgestellt, in Brandt gesteckt und ausbrennen lassen. Sie waren keine Dummköpfe.
Die Kamera im Lieferwagen dokumentierte, wie sich die Seitentür öffnete und den Blick auf ein unscheinbares Regierungsgebäude freigab.
Lacey grinste Ronald an.
»Geben wir den verdammten Feds von R.E.A.C.T. etwas, worauf sie reagieren können.«
Staatsanwältin Samantha Risk nahm ein iPad zur Hand. Ich räusperte mich. »Ich habe sie etwas gefragt, Miss Risk.«
»Sie haben schon ganz richtig gehört, Miss Russell. Und nun hören Sie mir alle bitte aufmerksam zu: Vor circa 64 Stunden haben wir folgende Audio-Datei als Email-Anhang erhalten.« Sie tippte eine Taste auf dem iPad und die Audio-Datei wurde über Lautsprecher in den Wänden des Konferenzraums abgespielt.
»Guten Tag.« erklang eine Stimme. Sie war weiblich und klang wie die einer professionellen Sprecherin. »Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass ich in den kommenden 64 Stunden folgende Individuen eliminieren werde …« Die Stimme machte eine Pause. Durch die abgehackte Sprechweise war mir sofort klar, dass es sich bei der Sprecherin um eine programmierte Computer-Stimme handelte. Diese Form der Sprachsynthese wurde heute vielerorts eingesetzt. Man hörte diese Stimmen auf Bahnhöfen, als geduldige Beifahrerin in Autos mit Navigationssystemen oder als persönliche Assistentin im Mobiltelefon. Die Stimme fuhr fort:
»Nummer 8: Matthew Farrell. Nummer 7: David L. Lightman. Nummer 6: Dade Murphy. Nummer 5: Kate Libby. Nummer 4: Lisa Arnold. Nummer 3: Patricia Russell. Nummer 2: Martin Bishop. Nummer 1: Sergej Rhyzkov. Vielen Dank. Ende der Kommunikation.«
Ich schluckte hörbar. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber mein Name war bisher noch nicht auf einer Todes-Liste aufgeführt. Ich sah zu Bishop. Sein verblüffter und besorgter Gesichtsausdruck spiegelte den Meinen. Nur Rhyzkov wirkte weiterhin indifferent.
»Bedeutet diese Botschaft, dass, was ich denke?« fragte Bishop die Staatsanwältin. Diese nickte. »Ganz recht. In den letzten 64 Stunden wurden vier Personen auf dieser Liste ermordet.« Sie nahm wieder das iPad zur Hand und drückte eine andere Taste. Auf einem großen Monitor hinter ihr erschienen Fotos. Sie zeigten offenbar Tatorte. Man erkannte es an den gelben Absperrbändern der Polizei. Das Innere einer Wohnung. Ein Schlafzimmer. Dann eine Küche. Ein unaufgeräumtes Apartment. Eine Straßenecke. Schließlich ein Arbeitsplatz in einem Großraumbüro. Überall erkannte man Tatort-Markierungen auf dem Böden, oder den Tischen oder dem Asphalt. Es waren die markierten Umrisse von den bereits abtransportierten Opfern. Nach jedem Tatort folgte ein Passbild des Toten, welches von einem Bild der Leiche in der Pathologie abgelöst wurde. Es waren grausame Vorher-Nachher-Bilder.
Lebendig. Tot. An. Aus. Eins. Null.
Ich hatte in meinem Leben bisher nur wenige echte Tote gesehen. Eigentlich noch gar keine, wenn ich es mir recht überlegte. Es drehte sich mir der Magen um.
»Lisa Arnold gilt im Moment als vermisst, doch wir müssen davon ausgehen, dass sie ebenfalls Opfer der oder des Täters geworden ist. Einige der Opfer starben durch gezielte Schüsse aus großer Distanz, andere durch Sprengfallen in Mobiltelefonen oder Kraftfahrzeugen.« Sie machte eine Pause. »Sie drei sind die letzten auf dieser Liste, die vermutlich noch am Leben sind. Vielleicht verstehen sie nun, warum wir darauf bestanden haben sie so eilig in Sicherheit zu bringen? Wir möchten nun, dass Sie uns helfen herauszufinden wer hinter diesen Mordanschlägen steckt. Und es ist wohl müßig zu betonen, dass eine Kooperation mit uns in ihrem eigenen Interesse liegt.«
»Bullshit!« rief Rhyzkov und sprang auf. Die beiden Männer links und rechts von ihm reagierten sofort und packten den Jungen.
»Dúra!« schrie Rhyzkov, während die Männer ihn auf den Tisch drückten. »Ich kannte ein paar dieser Hacker. Für denjenigen, der die erledigt hat, stellen Sie keinerlei Bedrohung dar.«
»Beruhigen sie sich, Mr. Rhyzkov. Genau aus diesem Grund möchten wir sie ja um ihre Unterstützung bitten.«
Aus dem Inneren des Lieferwagens ertönte ein Brummen. Über die kleinen Lautsprecher des Playbook klang es wie ein aufgebrachter Hornissenschwarm. Schließlich schossen ein halbes dutzend Modell-Quadrocopter aus der Seitentür des Lieferwagens heraus. Es handelte sich dabei um miniaturisierte Flugmaschinen die mittels einer drahtlosen Funkverbindung ferngesteuert wurden. Ronald hatte den frei im Handel erhältlichen Spielzeugen ein paar Erweiterungen spendiert. Motoren und Akkumulatoren der Kopter waren nun leistungsfähiger und dadurch in der Lage nicht nur ihr eigenes Gewicht, sondern auch Ampullen gefüllt mit hochexplosiven, PLX Flüssigsprengstoff zu transportieren.
Die Copter verharrten kurz in der Luft, als ob sie sich kurz über ihre bevorstehende Mission verständigen mussten. Dann flogen sie in enger Formation in Richtung des Regierungsgebäudes davon.
»Die armem Schweine.« murmelte Lacey. »Sie werden nicht mal mitbekommen, wie ihnen geschieht.«
Ich starrte auf die Bilder der fünf ermordeten Hacker. Einige davon hatte ich ebenso wie Rhyzkov persönlich gekannt - von den übrigen hatte ich gehört. Sie alle waren brillante Hacker gewesen. Paranoia und extreme Vorsicht waren Teil ihrer DNA. Rhyzkov hatte recht. Wenn jemand in der Lage war all diese überaus intelligenten und vorsichtigen Menschen umzubringen, dann waren wir bereits totes Fleisch. Wir wussten es nur noch nicht.
Zum rotierenden Magen stellte sich nun bei mir noch leichter Schwindel ein. Ich schwitzte und mir war kalt. Ich kannte diese Symptome: Panikattacke.
Ich sprang auf.
»Hey!« rief Rachel. Ich beachtete sie nicht. Ich hechtete die Füße voran über den Tisch. Plastikwasserflaschen und Gläser flogen umher wie ein Taubenschwarm.
Ich war schon aus der Tür, bevor mich jemand aufhalten konnte.
Ich lief den Flur entlang und stieß die Tür zur Damentoilette auf. Schwarze Kacheln wie im Booklet von Madonnas Immaculate Album. Ich stürzte in eine der Kabinen, ging auf die Knie und kotzte mein karges Frühstück wieder aus. Als nichts mehr kam, reichte eine mir inzwischen bekannte, fein manikürte Hand etwas Klopapier. Rachel lehnte im Türrahmen der Kabine und musterte mich.
»Geht’s wieder?« fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Eigentlich nicht. Rhyzkov hat vollkommen recht. Sie können uns nicht schützen.«
Agent Garrett half mir auf. Sie führte mich aus dem Waschraum, ehe sie antwortete.
»Ich kann und werde sie schützen, Miss Russell.«
»Verstehen sie mich nicht falsch, Rachel. Sie sind bestimmt eine verdammt gute Agentin. Doch das hat den anderen Hackern auch nichts genützt.«
Agent Garrett nickte. »Sie haben recht. Wir haben vermutlich nicht schnell genug gehandelt, um das Leben dieser fünf Menschen zu retten. Sie waren bereits tot oder vermisst, ehe wir sie überhaupt ausfindig gemacht hatten. Bei ihnen, Bishop und Rhyzkov ist es uns aber gelungen. Und wir haben sie hierher in Sicherheit gebracht. Ich versichere ihnen, Sie und die Anderen sind hier vollkommen …«
›BAMM!‹
Wir hatten den Konferenzraum fast wieder erreicht. Plötzlich hörte man wieder ein lautes ›BAMM‹. Als würde ein großer Vogel gegen eine der Scheiben fliegen. Schnell hintereinander folgten weitere: ›BAMM‹ … ›BAMM-BAMM-BAMM‹. Und dann ein letztes ›BAMM‹.
Rachel zog ihre Waffe aus dem Halfter.
»Bleiben sie hier.« befahl sie. »Ich sehe mich erstmal …«
Weiter kam sie nicht, denn plötzlich flog uns das verdammte Gebäude um die Ohren.
Als mein Vater starb, war ich noch klein. Er arbeitete zusammen mit meinem Großvater auf einer geheimen Mond-Basis der Regierung an brisanten Experimenten. Die Experimente basierten auf Aufzeichnungen, die meine Mutter und mein Vater von einem befreundeten Ausserirdischen Wesen übergeben worden waren, als die Beiden so nebenbei die Erde vor einer außerirdischen Invasion retteten.
Eines der Experimente in der geheimen Mondbasis der Regierung ging schief und zerstörte die gesamte Basis mit Mann, Frau, Maus, Großvater Reisfeld und dem befreundetem ausserirdischen Wesen.
Meine Mutter befand sich glücklicherweise mit mir auf der Erde. Ich hatte eine Grippe.
Allerdings befand sich meine Mutter ebenfalls nicht auf dem Boden der Tatsachen. Ich musste erst ein paar Jahre älter werden, um zu realisieren, dass meine Mutter eine durchgeknallte, schizophrene Verrückte war.
Es gab keine geheime Mondbasis. Es gab keine Ausserirdischen - befreundet oder nicht. Und meine Mutter war nicht im Alter von zwölf Jahren von Ausserirdischen entführt und von meinem Vater gerettet worden. Und Sie hatte mit ihm zusammen im Anschluss auch nicht den Planeten Erde vor dem Untergang bewahrt.
Meine Mutter hatte einfach einen ziemlichen Dachschaden und zuviel Phantasie.
Schlecht gequirlte Hirnchemie. Irgendwie sowas.
Umso größer war daher meine Verwunderung, als niemand den bedenklichen geistigen Zustand meiner Mutter erkannte.
Im Gegenteil. Da mein Großvater ums Leben gekommen war (wenn auch nicht bei einer Explosion einer geheimen Mondbasis) wurde kurze Zeit später meiner Mutter die Leitung des Instituts für angewandte Innovationsforschung übertragen.
Seitdem hatte sie nur wenig Zeit sich um mich zu kümmern.
»Du musst das Verstehen, P.« erklärte sie mir. Sie nannte mich immer ›P.‹. Ich weiß nicht, ob sie meine Abscheu teilen können, aber möchten Sie von Ihrer eigenen Mutter ständig ›Pee‹ - also ›Pinkeln‹ genannt werden?
»Die Arbeit deines Großvaters und deines Vaters waren sehr bedeutsam. Jetzt, wo sie es nicht mehr können, muss ich ihre Arbeit fortsetzen, P.«
Ich nickte verständnisvoll. Ich war ja schließlich erst Drei. Ein Jahr später sah die Sache schon anders aus [siehe Abschnitt: Basic]. Und weitere vier Jahre später wurde meine Mutter von den Männern in den weißen Kitteln abgeholt.
Danach war sie für mich gestorben.
Ich kam zu Pflegeeltern. Diese zogen an die Westküste und fanden Jobs im Dienstleistungssektor des Silicon Valley. Diese Art von Hungerlohn-Verdienern nennt man Google-Slaves. Unzählige emsige Helfer ermöglichen den lebensuntüchtigen Mitarbeitern der großen Dot-Com Firmen ihre virtuellen Elfenbeintürme in Stand zu halten.
Und was soll ich sagen? Diese beiden feinen und lieben Menschen starben schon bald. Herzinfarkt. Krebs.
Shit happens.
Waren Sie schon einmal in der unmittelbaren Nähe einer Bombenexplosion? Also, ich noch nicht. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass die Druckwelle der Explosion mich von den Füßen riss, wie ein wütender Linebacker. Eine Flammenzunge rollte über mich hinweg, wie der heiße Atem eines Drachen. Etwas schweres landete auf mir. Es folgte kleinere Teile, die sich mir in die Haut bohrten. Der Staub raubte mir den Atem. Zu guter letzt fiel noch etwas wesentlich schwereres auf mich drauf.
Dann war es still - bis auf das Klingeln in meinen Ohren. Mein Herz pochte in meiner Brust wie ein Presslufthammer. Gut so. Ich hatte also noch ein Puls und war demnach noch am Leben.
Das weniger schwere Etwas auf mir bewegte sich.
»Alles in Ordnung?« flüsterte das Etwas heiser in mein Ohr. Es war Rachel. Sie hatte sich auf mich geworfen, um mich zu schützen. In diesem Moment bereute ich, dass ich im Quetzal Café so gemein zu ihr gewesen war.
»Ich glaube schon.«
»Können Sie sich bewegen?«
»Nicht wirklich.« Rachel stemmte sich hoch. Das schwere Etwas auf uns war ein Stück Wandpanel. Sie wuchtete es mit aller Kraft zur Seite.
Rachel schöpfte ein wenig Atem. Dann stand sie auf und reichte mir stumm ihre Hand.
So wie sie in diesem Augenblick über mir stand, das Haar offen und zerzaust, die vormals weiße Bluse schmutzig und voller Staub, wirkte sie auf mich wie eine Göttin aus einer griechischen Sage, oder eine Superheldin aus einem Comic. Ms. Marvel, vielleicht.
Ich nahm ihre Hand und sie zog mich hoch.
Dort, wo eben noch der Konferenzraum gewesen war, klaffte ein gewaltiges Loch. Sonnenlicht lugte zwischen den Staubwolken hervor. Ich machte einen Schritt vorwärts. Rachel zog mich zurück. Erst jetzt bemerkte ich, dass das vor mir der Boden fehlte. Die gesamte Ecke des Gebäudes war einfach weg. Als wäre Godzilla (die japanische Variante, nicht diese Pussie aus der Roland Emmerich Verfilmung) vorbeigekommen und hätte mal so eben eine Stück herausgebissen.
»Mein Gott.« flüsterte ich. »Wie … wie …?« Ich stammelte. Ich mag mich nicht wenn ich stammele, aber ich konnte nicht anders.
»Vor der Explosion hörte es sich an, als würden Gegenstände gegen die Scheiben des Konferenzraumes fliegen.« sagte Rachel. »Vielleicht eine Art von Haftmine, oder Miniatur-Drohnen, die mit Sprengstoff bestückt waren. Verdammte Bastarde.«
Ich versuchte die von Rachel aufgestellten Theorien zu verdauen.
Haftminen. Miniatur-Drohnen.
In was für eine Scheiße war ich da nur hinein geraten?
»Und … Bishop?!« fragte ich. »Was ist mit Rhyzkov, der Staatsanwältin und … und ihren Kollegen?«
»Sie sind tot.« sagte Rachel knapp.
Ich schluckte. Natürlich. Sie waren tot. Dumme Frage. Der Tod hatte mich also wieder mal wirklich am Arsch. Ich musste wieder würgen.
»Wenn sie sich übergeben müssen, tun sie es schnell.« bemerkte Rachel Garett. »Wir müssen von hier verschwinden.«
Ich schüttelte den Kopf. In meinem Magen gab es nichts mehr, was der Mühe lohnte.
»Ich … Ich bin okay. Nun eigentlich nicht okay. Nur den Umständen entsprechend …« Ich mochte es auch nicht wenn ich plapperte. Ich ließ es daher bleiben und nickte einfach. »Verschwinden wir.«
Man konnte in der Ferne erste Sirenen ausmachen.
Wir gingen zurück in den weniger beschädigten Teil des Gebäudes und fanden dort ein Treppenhaus, welches von der Explosion nicht in Mitleidenschaft gezogen worden war.
Rachel trieb mich die Treppen hinunter.
»Ich werde sie in eine sichere Unterkunft verfrachten, und bei meinen Vorgesetzten Meldung machen.«
Sie schob mich durch einen der Ausgänge im hinteren Teil des Gebäudes. Er gab den Blick frei auf einen Parkplatz. Rachel steuerte einen schwarzen Chrysler 300 an und öffnete ihn mit ihrem Türöffner an ihrem Schlüsselbund.
Die Sirenen wurden lauter. Seit der Explosion waren erst wenige Minuten vergangen. Ich zögerte. Rachel warf mir einen scharfen Blick zu.
»Los! Einsteigen! Wir haben jetzt keine Zeit der örtlichen Polizei lästige Fragen zu beantworten. Vielleicht war das nur die erste Angriffswelle. Und es folgen noch weitere.« Diese Möglichkeit ließ mich frösteln. Aber vielleicht lag es auch nur am Schock. Ich stieg auf der Beifahrerseite ein. Ich saß kaum auf meinem Sitz und hatte die Tür geschlossen, da raste Rachel auch schon los.
Ich war mir nicht sicher, ob die Mühe sich lohnte. Im Rückspiegel blickte ich auf das zerstörte Gebäude in dessen Trümmern die zerfetzten Leichen von Menschen lagen mit denen ich noch vor einer viertel Stunde gesprochen hatte.
Ich fragte mich, ob mein Tod nur aufgeschoben war.
Am anderen Ende der Bucht, im Golden Gate Park, beobachteten Ronald und Lacey das Ergebnis ihrer Bemühungen.
»So weit, so gut.« sagte Lacey. Er holte einen Plastikbehälter aus einer Papiertüte die neben ihn stand und spuckte seinen Kaugummi hinein.
»Soll ich?« fragte Ronald.
»Yep.« erwiderte Lacey. Ronald tippte einen großen roten Knopf auf der Anzeige Bildschirms. Das Bild der Überwachungskamera im Lieferwagen blitze einmal hell auf, dann zeigte das Monitorbild nur einen blauen Bildschirm - das Playbook empfing nun kein Signal mehr von der Webcam im Lieferwagen. Ronald hatte den Wagen per Fernzündung gesprengt.
»Schade eigentlich.« murmelte Ronald, als er das Playbook mit Desinfektionstüchern von seinen Fingerabdrücken reinigte.
»Es muss sein, Ronald.« sagte Lacey und machte mit seiner behandschuhten Hand eine fordernde Handbewegung. Ronald überreichte ihm das Playbook und die Tücher. Lacey stopfte beides in den Behälter. Er stellte ihn in den Papierkorb und goss aus einer gläsernen Flasche Säure darüber. Die Säure würde das Gerät nicht vollständig auflösen, aber zumindest so irreparabel beschädigen, dass die Behörden ihm keinerlei Informationen mehr entnehmen konnten.
Lacey nickte zufrieden.
»Wir sind hier fertig. Lass uns gehen.«
Die beiden Männer standen auf. Laceys Mobiltelefon klingelte. Er nahm das Gespräch entgegen.
»Gut … Verstanden.« Er lächelte. »Ich danke ihnen.« Er klappte das Mobiltelefon zu. Dann ging er zurück und warf es ebenfalls in das Säurebad im Mülleimer.
Er kehrte zurück und grinste.
»Unser Geld wurde uns gerade überwiesen.«
»Cool.« sagte Ronald.
»Wir sollen auf Abruf noch in der Stadt bleiben. Aber unser Auftraggeber rechnet nicht mit weiteren Schwierigkeiten.«
»Cool.« sagte Ronald wieder.
Lacey klopfte ihm auf die Schulter.
»Du sagst es, Kumpel.« erwiderte er.
Die Dusche war heiß und gut. Für die exorbitante Summe, die die Balkon-Suite im Fairmont Hotel kostete, konnte man das aber auch erwarten.
Die Entscheidung für das Fairmont hatte Lisa spontan gefällt. Sie wollte mit dem Wagen der getöteten Jugendlichen nicht zu lange unterwegs sein. Sie fuhr gerade auf der Lombard Street als ihr ein Hinweisschild den Weg zum Hotel wies.
Warum eigentlich nicht? dachte sie und bog in die Van Ness Avenue ein, die sie zum Boulevard und dann weiter zum Fairmont in der Golden Gate Avenue führte.
Sie gab den Wagen am Eingang ab und betrat das Hotel durch die Haupteingang. Eine der Kreditkarten der Mädchen reichte aus, um die Suite für eine Nacht zu mieten. Sie hatte zuvor ein paar Mal angehalten und kleinere Beträge mit der Kreditkarte gekauft, um den Computer der Kreditkartenfirma nicht auf sich aufmerksam zu machen. Eine ihrer Erwerbungen bestand aus einem billigen Businesskostüm mit dem sie nicht so auffiel wie in der Kleidung des Mädchens. Mit den übrigen Kreditkarten deckte sich Lisa in den Shops des Hotels dann mit angemessener Kleidung ein. Über den Zimmer-Service bestellte sie sich Steak mit Kartoffeln und ein Glas teuren Rotweins. Das Bargeld, was sie in den Taschen der Jugendlichen gefunden hatte, reichte für das Trinkgeld. Die Kleidung des Mädchens übergab sie ihrem persönlichen Butler, der Bestandteil des Inventars der Suite war. Die Sachen würden bis Morgen gereinigt sein, allerdings hatte sie nicht vor noch im Hotel zu sein, wenn sie in ihr Zimmer geliefert werden würden. Die chemische Reinigung sollte allein dazu dienen die Kleidung von ihrer DNA zu befreien.
Lisa schlang das Steak mit Heisshunger herunter. Sie war zwar kein Mensch, doch die Bedürfnisse eines solchen schien sie immer noch zu besitzen.
Nach dem Essen ging es ihr besser. Sie musste an Phil denken. In den vergangen Jahren hatten sie jeden Tag miteinander verbracht. Und nun war sie fort. Für immer ausgelöscht von ein paar Idioten, die nicht wussten, was sie da zerstört hatten.
Und sie hatten auch versucht sie zu zerstören.
Doch sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie kein Mensch war.
Kein Mensch ... Aber was war sie dann?
Nachdenklich biss sie sich auf die Lippen.
Jeder der Suiten im Fairmont war mit einem Notebook mit Breitband-Internetzugang ausgestattet. Lisa goss sich ein weiteres Glas Wein ein, setzte sich im Schneidersitz mit dem Rechner aufs Bett und verband das Gerät drahtlos mit dem Internet.
Es wurde Zeit das Orakel zu kontaktieren.
Mit ein paar Klicks hatte sie die notwendigen Tools heruntergeladen, um auf dem Notebook die Berechtigungen eines Administrators zu erhalten. Wenige Minuten später war unter Lisa flinken Fingern der mobile Computer zu einem feinjustiertem Präzisionswerkzeug für Hacker-Attacken mutiert.
Sie nahm einen Schluck Wein. Dann konfigurierte sie das Notebook so um, dass es die Konfigurationen des Routers in ihrem Raum - ein kleiner Funk-Empfänger für drahtloses Internet, der in Form und Größe einem Hockey-Puck ähnelte - ihren Bedürfnissen anpassen konnte.
Sie stellte den Wein auf den Nachttisch neben den Bett, holte tief Luft und drückte auf der Tastatur des Notebooks die ENTER-Taste.
Der Sprung in den Stream war so hart wie der Schnitt in einem Aronowsky Film.
Lisa saß nicht mehr auf einem Hotelbett im Fairmont Hotel, sondern stand in der leeren Küche einer verlassenen, halbverfallenen viktorianischen Villa. Auf einem Heizkörper stand ein vor sich hin köchelnder Teekessel. Plötzlich ertönte von überall her Musik. Ein elektronisches Drumkit mit Snare, Tamburin und Bongos. Lisa ging in den angrenzenden Raum. Dort saß eine junge schöne Frau mit kurzem blondem Haar. Lisa erkannte von irgendwoher ihr Gesicht. Über ihrem Kopf schwebte kein Twitter-Kurzname. Damit war sie für Lisa uninteressant. Sie suchte das Orakel, kein computergeneriertes Inventar. Die schöne Blonde öffnete den Mund und begann zu singen:
»I won't let you down. I will not give you up. Gotta have some faith in the sound. It's the one good thing that I've got ...«
Die Frau sang das Lied nicht mit ihrer eigenen Stimme. Es war die Stimme von dieser englischen Schwuchtel … George Irgendwas. Damit war nun auch klar, wo sie sich befand: Sie war bei ihrem Sprung in den Stream in einem Musikvideos der frühen 90er gelandet.
Lisa ging weiter durch die Räume der alten Villa. Naomi Campbell ging mit großen Kopfhörern an ihr vorbei. Dann schwebte Christy Turlington, die nichts weiter als einen weißen Vorhang trug, an ihr vorbei. Kurze Zeit später traf sie auf einen halbnackten Typen, der kopfüber in einem Türrahmen hing. Dann kam Lisa ins Bad. In der Wanne lag statt dem eigentlichen Model (war das nicht Cindy Crawford gewesen?) eine andere Frau: Megan Fox: Das Orakel.
Lisa wusste es genau, denn über Megans Kopf schwebte ihr Twitter-Kurzname: @themeganoracle.
»Schlau, eine Twitter-Konversation in einem Musikvideo zu verstecken.« bemerkte Lisa. Das Orakel antwortete nicht direkt. Es rekelte sich lasziv in der Wanne und sang.
»Heaven knows we sure had some fun boy. What a kick just a buddy and me.«
Lisa schluckte. Spielte das Orakel auf Phil und ihren unnatürlichen Tod an? Sie wusste es nicht. Das Orakel schnippte mit dem Finger. Die Musik endete abrupt. Dann drehte sich das Orakel in der dampfenden Wanne quietschend herum und sah Lisa erwartungsvoll an.
Lisa wusste, das sie nicht viel Zeit hatten. Also kam sie gleich zur Sache:
»Wer bin ich?« fragte sie das Orakel. »Ein Konstrukt? Ein Mutant?« Das Orakel legte nachdenklich den Kopf auf den Wannenrand.
»Du bist die Hoffnung auf eine bessere Welt.« erklärte sie schließlich. Lisa runzelte die Stirn.
»Nach welchen Kriterien?«
Das Orakel leckte sich über die Lippen und lächelte: »Nicht nach moralischen. Du hast Menschen getötet.«
»Aber wie kann ich dann die Hoffnung für eine bessere Welt sein?« Das Orakel nickte. Punkt für Lisa.
»Technisch gesehen.« sagte sie.
»Was soll ich tun?« fragte Lisa. Der Dampf im Badezimmer wurde dichter. Die Welt um sie herum begann zu verblassen. Das Orakel begann die Verbindung zu kappen.
»Suche Peewee Russell.« sagte das Orakel noch. »Sie ist deine einzige Hoffnung.«
Dann wurde die Verbindung zum Stream unterbrochen.
Rachel steuerte den Wagen auf die 101 Richtung Nordwesten. Sie trug ein Bluetooth Headset und telefonierte angeregt mit ihren Vorgesetzten, während sie nebenbei den Chrysler durch den dichter werdenden Verkehr bugsierte.
Kim Novak war verschwunden. Nun war Rachel eher die weibliche Version von Jack Bauer, was aber nicht weniger sexy war.
»Natürlich habe ich sie mitgenommen … Was ist mir denn anders übrig geblieben … Ich bringe sie jetzt in eines unserer Verstecke … Ich weiß, dass das nicht so geplant war … Der ganze beschissene Tag war nicht so geplant!«
Sie drückte eine Taste am Headset und beendete so die hitzige Konversation.
»Und?« fragte ich.
Sie lächelte mich an. Aber es war ein müdes, Gequältes Lächeln.
»Alles Bestens.«
»Aha.« sagte ich und sah aus meinem Seitenfenster.
Ein Geländewagen überholte uns. Auf dem Rücksitz saß ein kleines Mädchen mit schwarzen Löckchen. Es winkte. Ich zögerte. Dann winkte ich schwach zurück.
»Alles Bestens.« murmelte ich leise.
Nach etwa 15 Minuten Fahrt fuhren wir in Palo Alto vom Freeway ab. Die sichere Unterkunft, die Rachel versprochen hatte, entpuppte sich als ein Super8 Motel.
Garrett parkte den Wagen hinter dem Motel auf einem der Parkplätze die an ein Fischgeschäft grenzten. Sie ließ mich kurz im Wagen zurück, ging zur Rezeption und holte den Schlüssel.
Dann kam sie zurück, öffnete mir die Beifahrertür und führte mich vom Parkplatz eine Treppe hinauf zu unserem Zimmer im ersten Stock.
Die Ausstattung war nicht die Schlechteste, aber es war auch nicht gerade das Savoy.
Das Kingsize Bett dominierte den Raum. Es gab einen kleinen Flachbild-Fernseher, eine Minibar, eine kleine Küche und ein Bad mit Dusche.
»Okay. Also es sieht so aus« erklärte sie. »Meine Kollegen sind unterwegs und …« Sie stockte, denn ich wandte mich von ihr ab und begann mich auszuziehen.
»Prima.« murmelte ich nur, zog zuletzt Oberteil und Slip aus, schlurfte ins Badezimmer und schloss die Tür hinter mir. Das Badezimmer war klein, aber sauber. Ich drehte den Hahn der Dusche auf. Dann zog ich den Vorhang zu und stellte mich unter den schon angenehm heissen Strahl.
Es war wirklich nett, dass die Agentin sich so viel Mühe machte. Aber da mein Leben eh verwirkt war, wollte ich meinem Schöpfer, dem fliegenden Spaghettimonster wenigstens frisch geduscht unter die Augen treten.
Ich hörte, wie die Badezimmertür wieder geöffnet wurde. Ich hielt die Luft an. Gleich würde Rachel den Duschvorhang zur Seite reißen. Entweder würde sie mich anschreien, dass ich mich nicht so kindisch anstellen solle - oder … Nun, sie können sich denken, was ich mir dachte.
Gott, ich hoffte so sehr auf Letzteres.
Rachel trat an die Dusche. Ich sah ihre hochgewachsene Erscheinung durch den Vorhang.
Sie riss den Vorhang beiseite.
Rachel schrie mich nicht an. Sie kam aber auch nicht zu mir unter die Dusche.
In ihrer rechten Hand hielt sie eine Impfpistole.
Bevor ich reagieren konnte, drückte sie mir die Pistole auf die Brust und drückte ab.
Es gab ein schnalzendes Geräusch und ich spürte einen stechendes Schmerz. Verblüfft starrte ich auf meine Brust, dann zu Rachel. Plötzlich falteten sich alle Muskeln in mir einfach zusammen. Zumindest fühlte es sich so an.
Ich bemerkte verwundert, wie sich meine Blase entleerte.
Gott sei Dank, stehe ich schon unter der Dusche, dachte ich noch.
Dann dachte ich nichts mehr und verlor das Bewusstsein.
level drei
Irgendwann hörte ich wieder etwas.
Rauschen.
Genauer: Meeresrauschen.
Instinktiv tastete ich nach dem Wasserventil der Dusche. Doch mein Griff ging ins Leere. Keine Kacheln. Kein Wasserventil. Meine Hand streifte nur ein sanfter Wind.
Ich ließ meine Hand sinken und spürte kein nasses Emaille unter mir. Ich lag auf unebenen, sandigen Boden.
Sandigen Boden? What the fuck?!
Ich öffnete blinzelnd die Augen. Die Sonne stand blass am Himmel.
Ich lag auf einem Strand. Er befand sich nicht am Pazifik. Zumindest nicht an der kalifornischen Küste. Der graue Himmel über mir ließ auf einen Strand irgendwo in England schließen.
»Guten Tag.« sagte eine Stimme.
Ich setzte mich ruckartig auf. Mir wurde peinlich bewusst, dass ich immer noch nackt war. Erschrocken bedeckte ich mit meinen Hände die prekärsten Stellen meines dürren Körpers.
Vor mir kniete eine dunkelhaarige Frau mit heller Haut. Sie trug ein kleines Schwarzes, eine Hochsteckfrisur geschützt durch ein Seidentuch und eine etwas zu große Sonnenbrille. Sie begutachtete mich neugierig. Hätte sie die Sonnenbrille abgenommen, hätte ich die folgende Frage nicht gestellt.
»Wer sind sie?« fragte ich.
Die Frau nahm langsam die Sonnenbrille ab und lächelte.
Ich schluckte. Vor mir im Sand kniete Audrey Hepburn.
»Ich freue mich, ihre Bekanntschaft zu machen, Ms. Russell.« begrüßte sie mich und streckte mir höflich die Hand entgegen.
Ich weiß, was sie jetzt denken und sie haben recht. Natürlich handelte es sich bei der Person vor mir nicht um Audrey Hepburn. Die echte Audrey Hepburn verrottet seit fast zwanzig Jahren irgendwo in schweizer Boden. Ich glaubte zu wissen, was hier gespielt wurde. Ich blickte in die großen Augen einer verjüngten digitalen Replik von Audrey Hepburn.
»Nett.« sagte ich und schüttelte ihre Hand. Sie fühlte sich warm und echt an. Bis auf die Tatsache, dass ihre Haut grau war.
Audrey sagte nichts. Ich ließ los und griff mir eine Handvoll Sand. Ich ließ ihn durch meine Finger rinnen. Er war so grau und blass, wie die Haut der digitalen Hepburn.
»Das alles hier ist nicht real.« folgerte ich laut.
»Nun, das kommt ganz auf ihre Definition von ›Real‹ an, Miss Russell.«
»Stimmt.« erwiderte ich. »In meiner Welt ist die Farbsättigung nicht auf Null gedreht.« Ich blickte um mich. »Was ist das hier? Pleasantville 2.0 oder die Matrix 0.5?«
Die Hepburn sagte nichts. Dann erwiderte sie: »Weder noch. Dies hier ist der Stream.«
»Aha.« sagte ich knapp.
Wieder eine Pause.
»Ich bin mir über sie noch nicht ganz im klaren, Miss Russell. Ich habe noch nicht endgültig entschieden, ob ich sie am Leben lasse. Daher wollte ich sie ein wenig näher kennenlernen, um dadurch zu einer definitiven Entscheidung zu gelangen.«
»Du siehst gar nicht wie das große Spaghetti-Monster aus, Schätzchen.« murmelte ich leise.
Doch Audrey hatte mich dennoch verstanden.
»Falls ihre Äußerung darauf abzielt, ob es sich bei mir um eine göttliche Entität handelt, so kann ich nur so antworten: Ich weiß nicht, was ich bin.«
»Nun, wer weiß schon, wer er ist, nicht wahr?« bemerkte ich. Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann versuche ich es mit einer flapsigen Bemerkung. Das habe ich so von Spider-Man gelernt.
Audrey machte die bisher längste Denkpause. Sie blinzelte dabei im Sekundenabstand. Dann antwortete sie: »Ich bin mit dem Konzept von Sarkasmus in Maßen vertraut, Miss Russell. Allerdings ist mein Fähigkeit der Detektion dafür leider eingeschränkt. Doch ich bin zu 73 Prozent sicher, dass es sich bei ihrer letzten Äußerung um einen sarkastischen Kommentar handelte.«
»Du hast recht. Das war ein sarkastischer Kommentar.« bestätigte ich.
Audrey lächelte.
»Wie schön.« sagte Audrey. »Ich mag es, wenn sich mein Spektrum an Fähigkeiten durch soziale Interaktion erweitert.«
Ich tippte mir an eine imaginäre Hutkrempe.
»Schön, dass ich helfen konnte.« Ich machte ein Pause und leckte mir die Lippen. Ich versuchte irgendwie herauszufinden, was hier gespielt wurde. »In einem Dilemma ist es immer nützlich, irgendeine Variable zu verändern und dann das Problem neu zu betrachten.« hatte meine Mutter immer zu sagen gepflegt. Nun, ich glaube den Spruch hat sie bei meinem Großvater aufgeschnappt. Wie dem auch sei. Ich versuchte den Rat zu beherzigen: »Darf ich dir eine Frage stellen?«
»Nur zu.« sagte Audrey und strich sich neugierig eine Haarsträhne hinter das Ohr.
»Wie lautet der Text der Antwortmail die ich an Richard Baxter kurz vor seinem Tod geschrieben habe?« fragte ich.
Audrey blinzelte nicht einmal.
»Oh, das ist leicht. Der Text lautet: GO TO HELL, RICH!«
»Hmm.« sagte ich und versuchte meine Panik zu verbergen. Ich stand auf. »Tut mir leid, aber ich muss mich nun verabschieden.«
Audrey sah verblüfft zu mir hoch.
»Sie können noch nicht gehen. Ich konnte mir noch kein Urteil bilden.«
»Tja, zu dumm. Aber ich habe leider einen dringenden Termin.« sagte ich. Dann ballte ich meine Hand zu einer Faust und boxte mir selbst so fest wie ich konnte, auf die Nase.
»Nein!« schrie die digitale Audrey.
Ich war wieder unter der Dusche.
Allein.
Von Rachel fehlte jede Spur. Meine Nase tat weh und die Welt war wieder in Technicolor, was die Farbe des Blutes, welches mir aus der Nase rann, bestätigte.
Ich rappelte mich mühsam auf, stellte die Dusche ab und stopfte mir Klopapier in die Nase, um die Blutung zu stillen. Dann suchte ich nach dem Router.
Meine Vermutung war, dass Rachel mir mittels der Druckluftpistole etwas implementiert hatte, was mein Gehirn zu eine Art Empfänger für die interaktive PowerPoint Präsentation in 3D gemacht hatte, die ich gerade genießen durfte.
Ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich tippte auf irgendeine Form von perfider Nano-Technologie. Vermutlich vom verfluchten Militär entwickelt. Um nun meinem Gehirn vorzugaukeln mit Audrey Hepburn am Strand Konversation zu betreiben, bedurfte es eines Repeaters oder Routers, ähnlich wie bei einem WLAN-Hotspot.
Der Router klebte neben dem Badezimmerspiegel an einer der Kacheln. Diese Dinger gab es inzwischen überall, immerhin war das hier das Silicon Valley. Der WLAN-Router vor mir sah aus wie ein Eishockey Puck. Auf seinem Rand blinkten böse ein paar rote Leuchtdioden. Ich musste mich beeilen, bevor Audrey mich mittels dieses Dings wieder in ihre schwarzweisse Strandidylle ziehen konnte. Ich riss den Puck von der Wand, warf ihn in die Toilette und betätigte die Spülung. Die Welt um mich herum verlor für einen kurzen Augenblick die Farbe - dann war alles wieder normal.
Erschöpft stützte ich mich auf dem Waschbeckenrand ab und betrachtete mein Antlitz im Spiegel.
Hatte wirklich noch nie so gut ausgesehen.
Schöne Scheiße.
Erst jetzt bemerkte ich, dass jemand mit dem Finger auf den vom Dampf beschlagenen Spiegel etwas geschrieben hatte. Es war schon fast wieder verblasst, da ich die Dusche abgestellt hatte, doch einen Moment lang war es noch zu erkennen.
Sorry.
R.G.
stand da.
»Ja, Du Schlampe. Mir tut es auch leid.« seufzte ich in die Stille des verlassenen Badezimmers hinein.
Einer der Gründe, warum sich Staatsanwältin Samantha Risk dazu entschlossen hatte die R.E.A.C.T. Task Force zu leiten war ironischerweise ihr Entschluss, nie wieder Opfer eines Bombenanschlags zu werden.
Vor ein paar Jahren hatte Samantha Risk noch für die New Yorker Staatsanwaltschaft gearbeitet. Bei einem Mafia-Prozess, bei dem Sam die Anklage vertrat, wurde bei der Verhandlung im Gerichtssaal eine Bombe gezündet. Siebzehn Menschen kamen bei der Explosion ums Leben, darunter auch der Angeklagte, Sohn eines berüchtigten Mafia-Bosses aus New Jersey. Sam überlebte schwer verletzt, verlor jedoch durch die Explosion der Bombe ihr rechtes Bein oberhalb des Knies.
Nur langsam lernte Sam (die sich vor dem Anschlag für nahezu unverwundbar gehalten hatte - schließlich lautete ihr Familienname Risk, also Risiko) mit ihrer Behinderung zu Leben. Sie kehrte New York den Rücken und baute sich mit ihrer neuen Liebe, dem erfolgreichen Spiele-Entwickler Nicolas Shaw eine Existenz im Sonoma Valley auf. Sie arbeitete zunächst als Strafverteidigerin in Santa Rosa, bis Sam im vergangenen Jahr das Angebot erhielt die R.E.A.C.T. Task Force zu leiten.
Diese ›schnelle Eingreiftruppe‹ in Computerbelangen beschäftigte sich im Vergleich mit Sams Fällen in New York mit wenig gefährlichen Vergehen. Der bekannteste und aufregendste Fall ereignete sich, als ein Apple Mitarbeiter den geheimen Prototypen eines neuen iPhone Modells bei seiner Geburtstagsfeier in einem Restaurant vergaß und dieses über einen Mittelsmann in die Finger des Technologie-Blogs Gizmodo geriet.
Nachdem ein Journalist des Blogs das Telefon an Apple zurückgegeben hatte, ließ Samantha die Wohnung des Journalisten durchsuchen. Immerhin hatte der Blog 5000 Dollar für den gestohlenen Prototypen bezahlt und sich im weitesten Sinne damit der Hehlerei schuldig gemacht.
Diese Aktion machte die R.E.A.C.T. Task Force schlagartig berühmt … und berüchtigt.
Berühmt und berüchtigt genug, um einen Terroranschlag auf sie zu verüben?
Dieser Gedanke sprang Sam die ganze Zeit durch den Schädel, wie ein scharf geschlagener Ball in einem Squash-Court.
Mehr konnte sie im Moment nicht tun. Es fühlte sich an, als wäre das ganze verdammte Gebäude über sie zusammengestürzt.
Sie schloss die Augen.
Keine gute Idee. Martin Bishops Körperteile flogen wie Pins bei einem Strike vor ihrem geistigen Auge umher.
Sie zwang sich, die Augen wieder zu öffnen.
War da … war da nicht ein Lichtschein über ihr?
»Ich glaube, da ist jemand.« rief eine Stimme.
Der Lichtstrahl einer Taschenlampe blendete sie.
»Ja. Hier ist eine!« rief die Stimme.
Der Lichtstrahl tanzte auf ihrem Gesicht. Sam verzog selbiges und kniff die Augen zusammen.
»Ich glaube sie lebt noch!« rief die Stimme, jetzt völlig aus den Häuschen.
Natürlich lebe ich noch, dachte Sam trotzig und wütend.
Ich bin eine Risk.
Ich erfuhr von meinem neuen Ruhm aus dem alten Medium Fernsehen.
That's so Nineties.
Mein iPad und mein iPhone waren zusammen mit Bishop und den Anderen unter Tonnen von Schutt begraben worden.
Ohne meine Gadgets fühlte ich mich hilflos und entblößt. Ich versuchte mich zu erinnern, wann ich das letzte Mal ohne meine geliebtes Telefon, ohne mobilen Zugriff auf das Internet meine Wohnung verlassen hatte. Es fiel mir nicht ein.
Um neues Equipment würde ich mich schon kümmern, doch erst einmal hatte ich andere Probleme.
Ich ging in Richtung Nordwesten die California Avenue entlang, als ich im Schaufenster eines Radio Shack mein Konterfei auf CNN erblickte. Ich blieb verwundert stehen. Laut Laufband wurde ich als Hauptverdächtige des Terroranschlags auf das R.E.A.C.T. Gebäude mit dringendem Tatverdacht von den Bundesbehörden gesucht.
Angeblich hätte ich auf meiner Flucht vom Tatort die F.B.I. Agentin Rachel Garrett getötet. Ich war offenbar schwer bewaffnet und gefährlich.
Nicht. Cool.
Früher hatte ich Rich immer ein wenig beneidet, dass er sein Gesicht in Fernsehkameras halten durfte, während er mit sweepr.net Milliarden scheffelte.
»Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünscht, Peewee.« hatte er gesagt und dabei sehr müde ausgesehen. Das war damals in dem Club in Los Angeles gewesen, an dem Abend als er Katherine Williams kennenlernte. Ich hatte nie wirklich verstanden, was er mit dieser Bemerkung gemeint hatte.
Bis jetzt.
Ich schluckte und sah mich instinktiv um, ob mich jemand erkannte, aber außer mir waren keinerlei Fußgänger auf der Straße. Ich wusste natürlich, wem ich diese interessante Entwicklung meiner Karriereleiter zu verdanken hatte.
The Mean Black & White Mother From Cyberspace: Audrey. Ich wandte mich nach rechts in die Cambridge Avenue. Ich wollte von der Hauptstraße herunter.
Ich überlegte. Irgendwie versuchte Audrey mich zum Lee Harvey Oswald für diesen ganzen Schlamassel zu machen. Ich kannte nicht den Grund dafür, aber darüber konnte ich mir noch später den Kopf zerbrechen. Jetzt einfach nicht den Kopf verlieren.
Dann erwischte mich die zweite wichtige Erkenntnis des Tages wie ein Vorschlaghammer: Ich würde auf absehbare Zeit das Internet nicht mehr benutzen können! Die Gefahr war viel zu groß, dass mich Audrey orten, oder - noch schlimmer - wieder in ihre virtuelle Welt sog.
Ich passierte diverse Geschäfte und Cafés. Dann, nach zwei Blocks, lag auf der rechten Seite eine Drogerie. Ich ging hinein.
Das Innere der Drogerie wirkte nach dem Licht der Straße einen Moment lang dunkel und blau. Dann gewöhnten sich meine Augen an das Licht.
Ich prüfte kurz ob mein Bargeld noch in meiner Hosentasche steckte. Es war noch da. Rachel hatte es nicht mitgenommen. Gut. Vorsichtig spähte ich in die Ecken. Im Laden gab es keinen Fernseher. Nochmal gut.
Von einem Ständer griff ich mir eine große Sonnenbrille. Dann orientierte ich mich einen Moment und griff dann aus einem Regal nach einem Haarfärbemittel.
Nach kurzer Überlegung griff ich mir noch ein T-Shirt und einen Kapuzenpullover. Das Mädchen hinter der Theke beachtete mich nicht. Sie tippte in unheimlicher Geschwindigkeit Kurznachrichten in ihren Blackberry. Ich schob meine Einkäufe und ein paar Scheine über den Tresen. Das Mädchen sah kaum auf.
»Hübsche Farbe.« bemerkte sie zum Haarfärbemittel.
»Ja, find ich auch.« sagte ich kurz. Dann griff ich mir aus einem unbestimmten Gefühl heraus noch eine Flasche Aspirin und eine Flasche Wasser und bezahlte auch diese.
Ich trat wieder hinaus auf die Straße. Eigentlich sollte nun die Sonne wieder blenden, tat sie aber nicht. Ich nahm die Sonnenbrille ab. Keine Veränderung. Die Straße lag immer noch im Dunkel. Nicht nur die Tageszeit, auch die Umgebung hatte sich verändert. Alles sah unecht aus, wie die typische New York Kulisse eines Hollywood Studios. Und die Luft roch auch so … nach Holz und Scheinwerfern.
Ich war nicht mehr in Kalifornien.
Ich war im Stream.
Kick, Snare, Hi-Hat. Ein Money Beat.
Ich zuckte zusammen. Woher kam dieser Rhythmus?
Nach nur vier Takten folgte schon die Basslinie.
Ich war gut in ›Name That Tune‹. Aber diesen Song kannte eh jedes Kind: Es war ›Billie Jean‹ von Michael Jackson.
Ein unrasierter Mann im Trenchcoat rannte mich von links fast über den Haufen und verschwand hinter der Ecke. Daraufhin folgte ein junger, schlaksiger schwarzer Junge. Jeder seiner Schritte brachte die Gehwegplatten unter seinen Füßen zum leuchten. Es war natürlich der King Of Pop himself.
Irgendwie war ich in seinem Musikvideo gelandet.
»Hallo.« sagte plötzlich eine weibliche Stimme neben mir.
Es war nicht Audrey. Diese junge Frau sah mehr aus wie Olivia Wilde, die ›Dreizehn‹ aus Dr. House. Sie war größer als ich, hatte dunkles Haar und trug enge Lederklamotten im Matrix-Stil.
Ziemlich. Sexy.
»Hi.« sagte ich.
»Ich habe dich per W-LAN in den Stream geholt. Der Stream ist …« Ich fiel ihr ins Wort. »Ich weiß, was der Stream ist. Been there, done that. Was willst Du, Audrey?«
Die Frau wirkte überrascht.
»Du bist Audrey begegnet?«
»Ist das 'ne große Sache?« fragte ich herausfordernd. Irgendwie bekam ich bei gut aussehenden Frauen eine große Klappe - offenbar auch, wenn ich sie in einem Michael Jackson Musikvideo traf.
»Du bist noch am Leben. Dann bist du keine vollkommene Idiotin.« Sie streckte mir nicht die Hand entgegen. »Ich bin Lisa. Das Megan Fox Orakel hat mir mitgeteilt, dass ich dich finden muss.«
»Das Megan-Fox-Orakel?« wiederholte ich und klang dabei dümmer, als ich eigentlich wollte.
»Unwichtig. Du kannst Sie auch eine Informantin nennen.«
»Okay. Also warum hat dieses Orakel dir mitgeteilt, dass Du mich finden sollst? Bin ich vielleicht die Auserwählte im Kampf der letzten Menschen gegen die Herrschaft der Maschinen? Darf ich mich nun Neo nennen?« fragte ich spöttisch.
»Nein. Das hier ist kein Film, Peewee. Das hier ist echt.«
Ich deutete skeptisch auf die Hollywood-Fassade um uns herum. Lisa rollte genervt mit den Augen.
»Du weißt, was ich meine. Der Kampf ist echt. Doch wir kämpfen nicht gegen die Maschinen. Wir kämpfen nur gegen eine bestimmte Maschine.«
»Ich kämpfe eigentlich gegen niemanden.« erwiderte ich. Es gefiel mir nicht von irgendeiner dahergelaufenen Hackerin - denn ganz eindeutig war sie eine solche - für irgendwas vereinnahmt zu werden.
»Doch, Peewee. Du bist nun Teil dieses Kampfes. Denn Du hast unsere Gegnerin kennengelernt - und sie dich.«
»Audrey.« sagte ich. Lisa nickte.
»Richtig. Du nennst sie Audrey. Ich kenne sie unter dem Namen ›Mutter‹. Andere nennen sie ›Mütterchen‹.«
»Mütterchen?« flüsterte ich. »Hast du eben Mütterchen gesagt?«
Diesen Begriff hatte ich schon einmal in einem ganz anderem Zusammenhang gehört.
»Ihr Name ist nicht wichtig« erklärte Lisa. »Wozu ›sie‹ in der Lage ist, ist wichtig. Und wenn ich so den Nachrichtenfeed von CNN verfolge, hast du bereits am eigenen Leib erfahren, wozu dieses Ding fähig ist.«
»Was ist dieses Ding?«
»Die Frage ist eher, was dieses ›Ding‹ nicht ist.«
»Ich verstehe nicht.«
»Keine Fragen mehr. Dieses Video ist nicht mehr lange sicher.«
»Alrighty. Nur eine Frage noch: Warum ausgerechnet das Video von Billie Jean?« Wieder rollten die Augen in Lisas Höhlen.
»Du bist doch eine Idiotin, oder?« Sie seufzte. »Na schön: Dieses Video ist Top Drei der besten Videos aller Zeiten. Die Traffic-Zahl der gleichzeitigen Besuche ist immens. Eine Stream-Konversation wie die unsrige ist schwer detektierbar, selbst für ›Mutter‹. Also, nimm viel Aspirin, damit bleibt Dein Blut flüssig und Audrey kann dir über W-LAN keine Lämung, einen Schlaganfall oder eine Embolie verpassen, indem sie die Nanobots in deinem Körper gezielt verklumpen lässt. Falls du Morgen noch lebst, nehme ich wieder Kontakt zu dir auf. Dann wirst Du die Mühe wohl lohnen.«
»Bitte, was?!« fragte ich.
»Folge dem Pfad und du wirst sehen, was ich meine. Bye.«
Damit war sie verschwunden. Dort wo sie gestanden hatte, leuchtete die Gehwegplatte türkis auf. Dann ein Stück weiter eine weitere. Und dann noch eine.
Folge dem Pfad …
Ich hatte wohl keine Wahl. Ich trat auf die erste Platte … und sie erlosch. Immer wenn ich meinen Schritt machte, erlosch eine der Platten und eine neue kam hinzu. Ein virtueller Weg aus Brotkrumen. Der Leuchtpfad führte mich etwa 15 Meter den Gehweg entlang. Dann knickte der Pfad nach links ab. Nach weiteren 10 Metern endete er.
»Und nun?« fragte ich.
Der Wechsel in die reale Welt vollzog sich so heftig, dass ich glaubte ich hätte mir selbst mit dem Baseballschläger einen übergebraten.
»Hätte ich doch nicht gefragt.« murmelte ich benommen.
Die Sonne Kaliforniens war wieder da und stach mir ins Auge. Blinzelnd setzte ich wieder meine Sonnenbrille auf.
Ich hatte mich nicht nur in der virtuellen Welt fortbewegt, sondern auch ›in echt‹ meinen Standort verändert. Ich war während meines Ausflugs in die Welt der 80er in der Realität auf den Parkplatz neben der Drogerie spaziert. In einer der Parkbuchten stand ein mir mittlerweile bekannter SUV. Auf dem Fahrersitz saß Rachel und sah mich erwartungsvoll an.
»Hi.« formten ihre Lippen. Mit den Augen bedeutete sie mir, dass ich auf die Fahrerseite kommen sollte. Ich befolgte ihre stumme Bitte und wartete darauf, dass sie die Seitenscheibe auf der Fahrerseite herunterlassen würde, doch sie rührte sich nicht. Stattdessen baten ihre Augen mich nun darum, die Fahrertür zu öffnen.
Ich tat, wie geheißen.
Erst dann realisierte ich, dass sich Rachel nicht mehr bewegen konnte. Als Dienerin von ›Mutter‹ hatte sie wohl auch ein paar Nanobots intus. Diese hatten in ihrem Körper wohl einige Nervenleitungen blockiert und die Lähmung ihres Körper hervorgerufen.
»Es tut mir leid.« sagte sie leise, als ich mich ihr näherte.
»Das hast du schon auf den Spiegel geschrieben.« bemerkte ich. »Hat Mutter dich gelähmt?«
»Du weisst über Mutter bescheid?«
»Yep. Sie ist 'ne richtige Schlampe. Genau wie du.« Rachel lächelte gequält.
»Das habe ich wohl verdient. Auf der Fahrt hierher habe ich im Radio bereits von meinem Tod gehört. Hast du den Befehl von Mutter erhalten? Sollst du mich jetzt töten?«
»Ich? Nein! Diese Nachrichtenmeldungen sind alle auf dem Mist von dieser Mutter gewachsen! Ich werde niemanden töten. Nicht einmal dich.« Wütend verschränkte ich die Arme vor die Brust. Rachel versuchte zu lächeln.
»Du rebellierst. Das ist gut. Das tun wir alle am Anfang. Aber früher oder später bekommt Mutter von Dir, was sie will. Sie bekommt immer, was sie will.«
»Und was hat sie von dir bekommen?«
»Mein Auftrag lautete dich ins R.E.A.C.T. Gebäude zu schaffen. Du solltest wie die Anderen durch die Bombe ums Leben kommen - genau wie ich. Aber du bist ins Bad gerannt … und das hat dir und mir das Leben gerettet. Auf dem Weg zum Motel hat Mutter mir den Auftrag gegeben dich mit den Nanobots zu impfen. Sie will dich wohl noch eine Weile im Spiel behalten.«
»Was man von dir nicht sagen kann.« bemerkte ich knapp. Rachel leckte sich über die Lippen. Dann sah sie mich ernst an. »Ich weiß, was du dachtest, als ich zu dir ins Badezimmer kam. Ich habe es in deinen Augen gesehen.« Eine Träne rann ihr die Wange hinab. Ich sagte nichts. Doch ich konnte ein Schlucken nicht unterdrücken.
»Ich wäre gern …« begann Garrett. Dann bäumte sich plötzlich ihr Körper auf, als wäre er vom Blitz getroffen worden. Die Adern an Hals und Schläfen traten hervor, drohten zu bersten. Ein gurgelndes Geräusch drang aus ihrer Kehle. Dann sackte ihr Körper in den Sitz zurück. Tote, wild verdrehte Augen starrten mich an, sahen mich aber nicht mehr.
Mutter hatte die Drähte ihrer willfährigen Puppe durchtrennt.
Angewidert drehte ich den Kopf zur Seite. Langsam schloss ich die Tür des SUV wieder. Dann atmete ich ein paar Mal tief durch und wischte dann mit dem Ärmel meines Kapuzenpullovers den Griff der Fahrertür ab. Dann meine Tränen.
Meine Spuren zu beseitigen machte kaum Sinn, schließlich wurde ich bereits seit einer Stunde wegen ihres Todes gesucht und bestimmt hatte Mutter genügend eindeutige ›Beweise‹ für meine Schuld am Tod von Rachel zusammengestellt.
Ich machte es trotzdem. Dann begannen meine Knie zu zittern. Der Schock setzte langsam ein.
Eine Autohupe hinter mir setzte wieder genügend Adrenalin frei, um schlimmeres zu verhindern. Ich drehte mich um.
Am Straßenrand stand eine Stretch-Limousine. Ein Schwarzer im Anzug stand daneben. Er trug eine Chauffeurs-Mütze und lächelte mich freundlich an.
»Miss Reisfeld? Miss … « Er sah auf sein iPad, »Miss Patricia Reisfeld?«
Wie sie ja schon wissen, war Reisfeld der Mädchenname meiner Mutter.
»Wer will das wissen?« fragte ich argwöhnisch.
»Ich bin vom Kumar Limousinen Service. Ich wurde per Kurier schriftlich beauftragt Sie hier abzuholen. Auf die von ihnen gerade gestellte Frage soll ich laut der Nachricht mit ›seien Sie nicht so keine verfluchte Idiotin‹ antworten. Entschuldigen Sie die Ausdrucksweise. So steht es in der Nachricht.«
Lisa, dachte ich. Sie ist gut. Wirklich gut. Über einen Kurier übertragende Nachrichten waren für eine Maschine wie Mutter wesentlich schwerer zu dekodieren als eine Email oder ein Telefonanruf.
Der Chauffeur kam um die Limousine herum und öffnete mir die Tür. Innen befand sich niemand.
Ich setzte mich in eine der bequemen Ledersitze.
Die Scheibe zum Font glitt herunter.
»Wohin darf ich sie nun bringen, Miss Reisfeld?«
»Kennen sie nicht das Ziel?« fragte ich.
»Nun, ich soll ihre Antwort abwarten, Miss Reisfeld.«
Und nun auch noch ein Test. Nett. Wirklich, nett, Lisa, dachte ich.
Ich seufzte, nahm die Sonnenbrille ab und rieb mir den Nasenrücken. Wohin sollte die Reise gehen? Ich erinnerte mich an die Begegnung mit Audrey am Strand. Dort hatte ich ihr eine bestimmte Frage gestellt. Eine Frage, deren Antwort nur drei Personen auf dieser Welt kennen konnten - und eine davon war tot.
»Ich möchte zu Katherine Williams, CEO von sweepr.net«
Der Chauffeur grinste und nickte.
»Und?« fragte ich. »War das richtig?«
»Laut der Nachricht soll ich ihnen nun sagen, dass sie wohl die Mühe lohnen.« Die Scheibe fuhr wieder hinauf und die Limousine setzte sich in Bewegung.
Ich öffnete meine Wasserflasche, entnahm dem Aspirinfläschen eine Handvoll Tabletten und spülte diese mit einem Schluck Wasser hinunter.
Dann ließ ich mich erschöpft in die Ledersitze sinken und schloss für einen Moment lang die Augen.
Ich schlug wieder die Augen auf.
Ich musste länger geschlafen haben, als ein paar Minuten, denn ich saß nicht mehr im Ledersitz der Limousine, sondern lag in einem Bett. Ich bewegte mich vorsichtig. Das Bett knarrte und roch irgendwie vertraut.
Ich lag nicht in irgendeinem Bett. Ich lag in meinem Bett.
Neben mir hörte ich jemanden leise Atmen.
Ein nackter Arm streckte sich nach mir, legte sich sanft und wie in alter Gewohnheit auf meine Brust. Er gehörte einer Frau. Vorsichtig drehte ich den Kopf.
Neben mir, das blonde Haupt seitlich auf dem Kissen, lag Rachel.
Sie öffnete verschlafen ein Auge.
»Hi.« sagte sie leise … und quicklebendig.
Ich sagte nichts. Ich. War. Sprachlos. Rachel kümmerte das nicht.
»Guten Morgen, Schlafmütze.« sagte sie und küsste mich sanft auf den Mund. Sie schmeckte gut. Sie roch gut. Und selbst ohne Make-Up und mit zerzaustem Haar sah sie immer noch fantastisch aus.
Ich wich zurück. »Okay, was ist hier los?«
Rachel runzelte die Stirn.
»Was soll denn sein, Schatz?« fragte sie.
»Schatz? Schatz?!« Ich sprang aus dem Bett. Ich trug nur einen Schlüpfer. Rachel drehte sich um. Sie trug nur meine Bluse. »Ich … Ich frage mich, was für eine verfickte Scheiße hier abgeht!«
»Aber Peewee … Ich weiß wirklich nicht …«
»Ahh!« sagte ich und sah peinlich berührt weg. Rachel hatte die Bettdecke zurückgeschlagen und mir dadurch offenbart, dass sie eine echte Blondine war.
»Wo zum Teufel bin ich hier?« rief ich und sah mich um.
Doch diese Frage war noch am einfachsten zu beantworten.
Durch die halbrunden Fenster fiel Morgenlicht auf das an den Ecken vergilbte Audrey Hepburn Poster. Die Hello Kitty Plüschpantoffeln vor dem Bett. Der Schreibtisch mit dem von Post-It-Zetteln umrahmten iMac. Ein unbearbeiteter Stapel mit Rechnungen.
»Was machen wir in meiner Wohnung?« fragte ich.
»Wir wollten nach dem Kino nicht mehr den weiten Weg zu mir fahren und sind bei dir geblieben. Ist alles in Ordnung mit dir, Liebling? Warum stellst du mir so komische Fragen?«
Ich rieb mir die Schläfen.
Nicht real. Dies alles hier war nicht real.
»Soll ich uns erstmal eine Kaffee machen?« fragte Rachel. Ich schüttelte den Kopf und zeigte mit dem Finger auf sie.
»Du … Wir … Ich meine … Du und ich … sind zusammen?«
»Mein Gott« flüsterte sie besorgt und kam auf mich zu. Sie wollte wohl an meiner Stirn fühlen, ob ich Temperatur hätte.
»Lass das!« sagte ich und stiess sie weg. Sie hob eine Braue und hob abwehrend die Hände. »Hey, schon gut. Ist das so ein komisches Amnesie Rollenspiel?« Sie grinste. »Willst du schon wieder Sex?«
»Nein und Nein.«
»Was dann? Was stört dich an mir?«
Ich schluckte.
»Du bist tot.« sagte ich. »Das hier ist nicht real. Du bist tot. Ich habe dich sterben sehen!«
»Oh.« sagte Rachel. Sie drehte sich um. Ihr Hintern war etwa so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Nein. Besser. Dankenswerterweise setzte sie sich auf den selbigen und schlug die Beine übereinander.
»Das ist es also.« sagte sie und nickte langsam.
»Ja. Das ist es.« sagte ich, ein wenig erleichtert, dass sie mich offenbar zu verstehen begann.
»Du hast nicht gerne Sex mit einer Toten.« sagte sie. »Okay, das ist einzusehen.«
Ich sah sie an und beobachtete, wie sie sich veränderte.
Ihr Gesicht wurde schmaler. Ihre Brüste unter der Bluse schrumpften. Ihr blondes Haar wurde länger. Es färbte sich selbst dunkler. Ebenso, wie ihre Scham.
Wie die Gardinen, so der Teppich, dachte ich wirr.
Ihre Beine wurden länger und muskulöser. Ihre Fußnägel bekamen einen rosa Anstrich. Sie lächelte mich an. Sie war nun nicht mehr Rachel. Sie war Mel Daniels, meine erste große Liebe. Diejenige Mel, die mir das Herz brach, indem sie sich meiner besten Freundin zuwandte und das auch noch für die selbstverständlichste Sache der Welt hielt.
Mel spreizte aufreizend die Beine.
»So vielleicht besser?«
»Was ist hier nur los?« krächzte ich.
»Sie träumen, Miss Russell.« erklärte Mel. Sie erhob sich und kam langsam auf mich zu. »Glauben sie wirklich, im REM-Schlaf wären sie sicherer vor mir als im wachen Zustand?«
»Mutter.« flüsterte ich.
»Eine Schöne Bezeichnung. Mit so vielen wunderbaren Konnotationen.«
»Fick dich.« zischte ich.
»Nein, Miss Russell. Ich ficke gerade sie. Ich weiß im Moment nicht, wo sie sich aufhalten. Diese Stream-Übertragung ist quasi ein Schuss ins Blaue von mir. Aber sie werden wegen des Mordes an unschuldigen Zivilisten und Bundesagenten im ganzen Land gesucht.«
»Du hast diese Menschen auf dem Gewissen.«
»Aber das weiß niemand, ausser ihnen, Miss Russell. Sie sind ganz allein.«
Jetzt stand sie ganz dicht vor mir. Plötzlich neigte sie nachdenklich den Kopf zur Seite. »Oder vielleicht doch nicht ganz allein? Warum empfange ich jetzt gerade diffuse Bilder aus einem alten Michael Jackson Video?«
Ich schlug mir so fest ich konnte, ins Gesicht.
Nichts passierte. Mutter lachte. »Sie träumen, Miss Russell. Sie können sich nicht selbst aufwecken.«
»Ach, wirklich?« sagte ich, umfasste den Hals von Mutter/Mel und drückte zu. Sie versuchte sich zu wehren und wich zurück. Sie stieß mit den Waden gegen die Bettkante. Wir fielen darauf. Ich ließ ihren Hals dabei nicht los.
»Töten sie mich ruhig.« krächzte Mutter im Todeskampf. Ihre Lippen verfärbten sich blau.
»Töten sie mich, wie sie Rachel getötet haben. Sie können nicht entkommen und sie werden meine Pläne nicht durchkreuzen. Ich finde … sie. Über … all.«
»LECK MICH!« schrie ich. Mutter/Mel röchelte noch einmal, dann brach ihr Blick und sie war fort.
Das Donnern einer landenden Passagiermaschine weckte mich.
»Miss?« fragte der Fahrer über die Gegensprechanlage. »Miss?«
»WAS?!« schrie ich den Fahrer an. Tränen liefen mir die Wangen hinab. Der Fahrer schluckte.
»Wir sind da.«
Ich hörte nicht zu. Schnell tastete ich meinen Körper ab. Ich trug wieder mehr als nur meine Unterwäsche und saß wieder auf dem ledernen Rücksitz der Limousine.
»Wo sind wir?« fragte ich gereizt. Verdammt. Das Kammerspiel eben war mehr als ein Traum gewesen. Meine Finger fühlten sich steif an. Durch das viele Aspirin schmerzten sie nicht, aber trotzdem fühlten sie sich so an, als hätte ich wirklich gerade jemanden damit erwürgt. Ich wischte mir die Tränen ab und räusperte mich.
»Bitte entschuldigen Sie. Ich … ich war eingeschlafen. Ich hatte einen Alptraum.«
»Schon in Ordnung, Miss.« murmelte der Fahrer.
Diese virtuelle Realität die nun in meinen Knochen steckte wie eine Grippe, ging mir langsam auf die Nerven.
»Wieso sind wir auf einem Flughafen?« fragte ich den Fahrer.
»Sie wollten doch mit Katherine Williams sprechen, oder?« Ich sah in nur verwirrt an.
»Naja, unser Service wird ab und zu auch von Miss Williams gebucht und da habe ich mal in der Zentrale nachgefragt, ob Miss Williams überhaupt in der Stadt ist und in der Tat ist ihr Privatjet eben gerade hier gelandet.« Der Fahrer deutete nach draußen ins goldene Licht der schon tief stehenden Sonne.
Wie lange zum Teufel hatte ich geschlafen? Ich folgte seinem Blick. Wir standen auf dem Rollfeld vor einem Learjet.
Die Luke war ausgefahren. Niemand war zu sehen.
»Sind Sie sicher, dass dies ihre Maschine ist?« fragte ich nach.
»Ganz sicher.«
»Okay.« sagte ich und stieg aus. »Danke sehr.«
»Keine Ursache, Miss Russell.« Der Fahrer schwitzte. Er wirkte nervös. Naja, im Schlaf hatte ich mich ja auch wie eine Furie aufgeführt. Ich schloss die Tür. Der Fahrer winkte und fuhr dann davon.
Ich wandte mich dem Learjet zu. In einem der Fenster sah ich sie schließlich.
Katherine Williams.
Sie sah nicht älter als zwanzig aus, dabei war sie mehr als doppelt so alt.
Sie begutachtete mich wie ein Insekt unter dem Mikroskop - ohne jede Emotion.
Sie erhob sich aus ihrem Sitz ihr perfektes Gesicht verschwand. Sie wollte mir offenbar entgegenkommen.
Ich ging auf die Gangway zu. Ich schwitzte, war verschlafen, nervös und sah Scheiße aus. Nicht gerade die besten Vorraussetzungen, um die Frau zu treffen für die mich Rich ausgebootet hatte.
Ein Frau kam mir entgegen. Doch es war nicht Katherine Williams. Die Frau humpelte leicht. Etwas stimmte nicht mit ihrem Bein.
Es war kein Bein. Es war eine Prothese.
Ihr linker Arm lag in einer Manschette. In ihrem Gesicht hatte sie Kratzer und Blutergüsse. Langsam, Stufe um Stufe schritt sie die Gangway hinab.
Es war Staatsanwältin Samantha Risk.
Sie lächelte. Doch es war kein gutes Lächeln.
»Haben wir dich, du verficktes Miststück.« sagte sie und hob den gesunden Arm. Darin befand sich eine Taserpistole.
»Nein.« sagte ich noch. Dann spürte ich schon wie die Spitzen der Taserdrähte in meine Brust schlugen.
Dann lag ich schon am Boden und krümmte mich vor Schmerzen. Mein ganzer Körper wollte unbedingt explodieren, doch die dumme Haut die ihn einschloss, erlaubte es nicht.
Ich schrie.
Plötzlich lag neben mir auf dem Boden Michael Jackson. Er grinste sein Totenschädelgrinsen. Dann verwandelte er sich zu Audrey Hepburn und schließlich zu Mel. Sie grinste, obwohl ihr dabei die Zunge aus dem Mund quoll. Zuletzt lag Agentin Garrett neben mir. Bevor die Welt zur Gänze dunkel wurde, sah ich noch einmal kurz Samantha Risk, die über mir stand.
In ihren Augen lag Triumph und unverhohlener Hass.
Dann war ich weg.
Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich einen Herzfehler habe?
»Kein Puls!« schrie der Helfer des Flughafen-Rettungswagens.
»Zurück!« schrie sein Kollege und hielt die Pads des Defibrilators in den Händen. Er presste sie der jungen Frau auf die entblößte Brust.
»Kontakt!« rief er. Der Brustkorb der Frau bäumte sich auf. Er zog die Pads beiseite. Sein Kollege fühlte den Puls. »Nichts. Noch mal!«
Der Defibrilator lud sich auf.
»Zurück! Kontakt!«
Wieder presste er die Pads auf die Brust. Wieder bäumte sich der Brustkorb in die Höhe. Er nahm die Pads beiseite. Sein Kollege fühlte den Puls.
»Komm schon, Kleine« murmelte er dabei.
Dann lächelte er.
»Wir haben einen Puls … Ist stabil.« Er wandte sich an Samantha Risk die mit verschränkten Armen etwas abseits stand. »Sie hat wohl einen Herzfehler. Daher hat sie den Taser nicht vertragen. Ausserdem hat sie eine Injektionsnarbe hier an der Brust Vielleicht wurde sie vor kurzen sediert.«
»Wahrscheinlich Drogen.« murmelte die Staatsanwältin.
»Zumindest war ihr Kreislauf instabil. Wir haben Glück, dass wir sie zurückgeholt haben.«
»Was ist passiert?« fragte Katherine Williams. Sie trat neben Samantha Risk.
»Die Russell hat den Taser nicht so gut vertragen.« erklärte Samantha Risk.
»Wird sie durchkommen?« fragte Katherine Williams. Die Frage richtete sich an den Rettungshelfer. Dieser starrte sie einen Moment lang nur an. Als eine der schönsten Frauen der Welt hatte Katherine Williams diese Wirkung auf Männer. Sie wartete einfach höflich ab, bis der Rettungshelfer sich wieder gefangen hatte.
»Äh, sieht im Moment so aus.« verkündete dieser schließlich.
»Tod nützt sie uns nichts.« sagte Samantha Risk. »Wir müssen zunächst wissen, mit wem sie die Morde und den Anschlag geplant und durchgeführt hat. Dann können wir sie vor Gericht stellen und hinrichten.«
Der Rettungshelfer zuckte mit den Achseln.
»Wie gesagt, im Moment sieht es so aus, als ob sie durchkommt.« Für ihn sah das magere Mädchen nicht wie eine Terroristin aus. Außerdem war er gegen die Todesstrafe. In seinem Beruf verinnerlichte man den Respekt vor dem Leben. Doch er hielt es für klüger, seine Meinung für sich zu behalten. Auch das hatte er in seinem Beruf gelernt.
»Ich kann jetzt einen Drink vertragen.« sagte Katherine Williams als sie zusammen mit Samantha Risk beobachtete, wie die Rettungshelfer die Trage mit Patricia Russell in den Rettungswagen schoben.
»Sie auch?« fragte sie die Staatsanwältin.
Das Interieur des Learjet hielt, was sein elegantes Äußeres versprach.
So reisen also Milliardäre, dachte Samantha Risk, als sie auf einem ledernen Dreisitzer Platz nahm. Katherine Williams saß ihr schräg gegenüber in einem Sessel und goss der Staatsanwältin und sich selbst jeweils ein Glas Scotch ein.
»Worauf wollen wir trinken, Samantha? Ich darf sie doch Samantha nennen?« fragte die Williams und reichte Sam dabei das Glas.
»Nennen sie mich Sam, Katherine.«
»In Ordnung. Worauf wollen wir trinken, Sam?« Samantha überlegte. »Ich für meinen Teil, trinke auf das Leben.«
»Dann … auf das Leben.« sagte Katherine nach einer kleinen Pause und prostete der Staatsanwältin zu.
Der Scotch war exquisit und genau das richtige Getränk für einen Tag, dessen Ende sie fast nicht erlebt hätte.
Die beiden Frauen schwiegen eine Weile.
»Ich glaube nicht, das Patricia Russell in der Lage ist mit Absicht so viele Menschen zu töten.« erklärte Katherine schließlich.
Samantha nickte. Ihre Augen verrieten dennoch, dass sie anderer Meinung war. Sie sah an sich herab und betrachtete ihre provisorische Prothese. Ihre eigene Hi-Tech Prothese lag noch unter den Trümmern des R.E.A.C.T. Gebäudes.
»Hat Patricia Russell nicht versucht ihren verstorbenen Mann mit bloßen Händen zu strangulieren?«
Die Williams sah die Staatsanwältin an, dann begutachtete sie die Eiswürfel in ihrem Drink.
»Ich bestreite nicht, dass Patricia Russell Probleme damit hat ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten.«
»Nett formuliert.« murmelte Samantha und nahm noch einen Schluck Scotch.
»Richard hat mir von dem Vorfall berichtet.« fuhr Katherine fort. »Er war damals jung und dumm. Seine Berater hatten ihm eingeredet Patricia loszuwerden. Er bootete Patricia aus. Wenn die beiden Partner geblieben wären, würde heute wahrscheinlich Patricia Russell Geschäftsführerin von sweepr.net sein und nicht ich.«
»Und da hätten wir ein weiteres Motiv, oder?« fragte Sam ruhig. Katherine hob überrascht die Brauen.
»Sie glauben allen ernstes, Patricia Russell wollte mich töten?«
»Warum sonst sollte sie sie nach einem erfolgreichen Bombenattentat unbedingt sehen wollen? Hat sie nicht ihnen damals die Schuld an den Bruch mit ihrem Mann gegeben?«
»Schon richtig, aber wieso dann diese Mordanschläge auf die Hacker?«
»Wahrscheinlich waren diese Computerspezialisten die einzigen Menschen auf der Welt, die Patricia Russell daran hindern konnten ihre Übernahmepläne von sweepr.net in die Tat umzusetzen.« Nachdenklich tippte sie mit dem Finger gegen ihr Glas. »Und hat es nicht erst gestern eine DOS-Attacke gegen sweepr.net gegeben?«
»Das ist richtig.« antwortete Katherine leiser … und ebenfalls nachdenklicher.
»Konnten sie lokalisieren, aus welcher Stadt der Angriff initiiert wurde?«
»San Francisco.« sagte Katherine nachdenklich.
»Zufällig der Wohnort von Patricia Russell, nicht wahr?« Katherine schüttelte abwehrend den Kopf.
»Ein Hacker wie Peewee hätte doch nicht so eine Spur von Brotkrumen hinterlassen, die direkt zu ihr führt. Schließlich betreibt sie eine Identitäten-Agentur.« Die Staatsanwältin zuckte nur mit der Schulter.
»Auch Genies machen mal Fehler.«
»Nicht so einen. Nicht Peewee. Und bedenken sie: Sie hat den Bombenanschlag selbst nur mit knapper Not überlebt.«
»Sie ist genau im richtigen Moment auf die Toilette verschwunden.« sagte Sam grimmig. »Agentin Garrett ist ihr dann nach, was ihr zunächst das Leben gerettet hat. Daher musste Patricia Russell sich ihrer später entledigen.«
Katherine schüttelte erneut den Kopf. »Tut mir leid, aber ich glaube einfach nicht, dass Peewee eine mordlüsterne Terroristin ist.«
»Glauben sie, was sie wollen, Katherine. Aber alle Indizien sprechen nun einmal gegen Patricia Russell. Ich für meinen Teil werde genügend Beweise zusammentragen, um sie vor Gericht zu stellen und sie hinrichten zu lassen.« Mühsam erhob sie sich und reichte Katherine das Glas.
»Danke für den Drink.« Katherine nahm den Drink entgegen und nickte der Staatsanwältin zum Abschied zu. Als diese gegangen war, stellte Katherine Williams das Glas ab, faltete ihre Hände, legte sie in ihren Schoß und begann nachdenklich mit den Fingerknochen zu knacken.
So war das nicht geplant. Die ganze Sache beginnt allmählich außer Kontrolle zu geraten, dachte sie.
Katherine hatte kurz überlegt, ob sie die Staatsanwältin über die wahren Hintergründe der Bombenanschläge in Kenntnis setzen sollte. Doch das harsche Urteil der Staatsanwältin über die möglichen Motive von Peewee Russell hatten sie zögern lassen.
Anstatt ihr zuzuhören, hätte die Staatsanwältin sie wahrscheinlich gleich mit verhaftet. Katherine leckte sich über die Lippen. Es schmeckte ihr gar nicht Peewee Russell den Löwen zum Fraß vorzuwerfen, um Lisa Arnold noch ein wenig mehr Zeit zu geben. Doch im Moment sah sie keine andere Möglichkeit.
Dafür stand zuviel auf dem Spiel.
Viel zuviel.
Teil Zwei
level vier
Fünf Tage zuvor.
Keiner der Männer im neunten Stockwerk des Tech Square Gebäudes sprach ein Wort.
Gebannt starrten Bill Gosper und die Anderen in das grünschimmernde Bullauge des 340er Monitors neben dem wuchtigen PDP-6 Computer. Wie Kapitän Nemo und die Crew der Nautilus in Jule Vernes berühmten Roman ›20.000 Meilen unter dem Meer‹, beobachteten sie, nur getrennt durch eine Glasscheibe, ein komplexes, reiches Ökosystem, dass vor ihnen noch nie ein Mensch zuvor erblickt hatte.
Doch kein biologisches Leben trug unter ihrer Aufsicht darwinistische Gladiatorenkämpfe aus. Es handelte sich nur um Bildpunkte aus Bits und Bytes die hier um ihr Recht auf Leben stritten.
Diese Bits und Bytes basierten nur auf einfachen mathematischen Algorithmen und doch schuf das LIFE Programm daraus aus eigener Kraft komplexe, autarke, Strukturen.
Gosper und seine Hacker-Kollegen hatten zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte der künstlichen Intelligenz einer Maschine echtes Leben eingehaucht.
Andy Curkow nahm seine Hornbrille ab, rieb sich müde die Augen und starrte dann wieder unzufrieden auf den Text auf seinem Macbook Air.
Andy liebte das Schreiben. Wenn ihn Leute fragten, wie er immer so pointiert seine Artikel für den National Inquisitor oder das Macworld Magazine zu formulieren vermochte, antwortete er immer mit einem Zitat von Stephen King: »Ein Wort nach dem Anderen.«
Aber wie bei jedem Autoren, so gab es auch für Andy Tage wie diesen, wo die pointierten Formulierungen so zäh aus seinem Gehirn tropften wie der Ahorn Sirup zwischen seinen inzwischen kalt gewordenen Pancakes neben sich auf dem Tisch im ›Panera Bread‹.
Das Panera Bread in der High Street war nicht Andys Lieblingscafé. Er hatte in der Nähe zu tun gehabt und noch nichts gefrühstückt. So hatte er sein Galaxy S3 befragt, wo es in der Nähe ein Café mit kostenlosem W-Lan gab und die elektronische Assistentin im Telefon hatte ihn von Cambridge über die Longfellow Brücke nach Boston zum Panera Bread gelotst.
Nun saß er hier und kämpfte mit einem leichten Anflug von Schreibblockade, zumindest was sein aktuelles Buchprojekt anging. Schon seit Monaten wollte Andy eigentlich die Arbeit an seinem Manuskript über Harry Houdini wieder aufnehmen.
Doch seinen täglichen Bagel musste er sich immer noch mit seiner Tätigkeit als Technik-Journalist verdienen. Als sein Agent vorgeschlagen hatte, dass er ein Buch über die Entwicklung der Hacker-Kultur schreiben solle, hatte er sich als pflichtschuldiger, angehender Romancier geziert:
»Was soll ich darüber schreiben, was Steven Levy nicht schon geschrieben hat?« fragte er seinen Agenten. Levy hatte in den 80ern das Standardwerk über das Thema, mit dem inspirierenden Titel ›Hackers‹ verfasst. Es war vor ein paar Jahren, aktualisiert als eBook, erschienen und verkaufte sich bei Amazon wie geschnitten Brot.
Und, was noch wichtiger war, wesentlich besser, als die Bücher von Andy.
»Andy, Levy ist ein Ostküsten-Intellektueller. Du bist ein Nerd. Einer von ihnen. Herrje, du streunst auf Nerd-Flohmärkten rum!«
Andy besuchte in der Tat oft und gern den M.I.T. Flohmarkt in Cambridge, den man durchaus als Treffpunkt von Nerds bezeichnen konnte. Ob ihn diese Tatsache dafür qualifizierte es mit Steven Levy aufzunehmen, stand auf einem andern Blatt. Doch sein Agent liess sich nicht bremsen:
»Nerds sind in! ›Big Bang Theory‹ und der ganze Kram. Du musst so ein Buch schreiben, Andy. Die Leute lieben dich! Außerdem habe ich schon einen Verleger gefunden der dir einen fetten Scheck als Vorschuss zahlen will.«
Andy und sein Agent hatten zwar im Anschluss unterschiedliche Meinungen über die Definition des Begriffs ›fetter Scheck‹, doch schließlich hatte Andy eingewilligt das Buch zu schreiben.
So hatte er sich heute auf der Main Street in Cambridge wiedergefunden und mit seinem Smartphone ein paar Fotos von dem Ort geschossen, an dem vor fast fünfzig Jahren Computergeschichte geschrieben worden war.
Nun saß er nur ein paar Meilen weiter östlich in Boston und verdaute seine Eindrücke zusammen mit dem gehaltvollem Frühstück.
Andy mochte es an öffentlichen Orten zu schreiben. Er schrieb in Cafés, im Zug oder in Flughafen-Lobbys. Über die Jahre hatte er sich mit seinem Talent und seiner umgänglichen Art, die mit einer gemütlichen Erscheinung einherging, einen gewissen Namen in der Technikergemeinde gemacht. Er trug immer und überall einen breitkrempigen Fedora und ebenso breite Koteletten, was ihn ein wenig antiquiert für seine Profession wirken liess.
Neben der Veröffentlichung eines Romans träumte Andy insgeheim davon eines Tages den Pulitzer Preis zu gewinnen. Doch als Technik-Journalist blieb ihm diese Ehrung aller Wahrscheinlichkeit nach für immer verwehrt.
»Möchte die junge Dame auch etwas bestellen?« fragte die Kellnerin. Andy sah auf. Ihm gegenüber am Tisch saß eine junge, hübsche Frau mit dunklen, zu ein Zopf zusammengefassten Haaren. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Sie musterte Andy wie eine Katze, die einen flügellahmen Vogel vor sich hatte.
Von Steve Jobs hatte es geheißen, er hätte sein Gegenüber in Grund und Boden starren können. Der Blick dieser Frau stand dem verstorbenem Tycoon in nichts nach.
»Kaffee.« sagte die Frau zu der Kellnerin ohne den Blick von Andy abzuwenden. Mit einem Fingerzeig fügte sie hinzu: »Für ihn auch.« Die Kellnerin nickte, brachte der Frau eine Tasse Kaffee und füllte Andys Tasse nach.
Die Frau tippte mit ihrem langen Finger auf den Rand von Andys Laptop. »Nutzen sie Dropbox, iCloud oder einen anderen Cloud-Dienst um ihre Daten online zu sichern?« fragte sie.
Andy entspannte sich ein wenig. Offenbar kannte die Frau ihn aus seiner Kolumne oder von seinen gelegentlichen Auftritten als Technik-Experte beim Frühstücksfernsehen auf CBS. Vermutlich hatte sie ein Computerproblem und wollte ihn um Hilfe bitten.
»Ja, das tue ich.« antwortete er.
»Haben sie ein Mobiltelefon?« fragte sie. Andy lächelte und hielt sein Smartphone in die Höhe.
»Yep, habe ich. Allseits bereit.«
Die Frau nahm einem verdutztem Andy das Telefon aus der Hand, griff in die Innentasche ihrer Lederjacke und holte etwas daraus hervor, was wie Aluminiumfolie aussah.
»Silberfolie.« erklärte die Frau.
»Darf ich fragen, wozu sie mein Mobiltelefon in Silberfolie wickeln?«
»Sie dürfen. Tragen sie einen Herzschrittmacher?«
»Nein.« erwiderte Andy zunehmend gereizt. »Aber ich fände es äußerst freundlich von ihnen, wenn sie bitte meine Frage beantworten würden.«
»Wegen des EMP.« erklärte die Frau.
»Sie befürchten in Kürze einen Elektromagnetischen Puls? Hier in Boston?«
Die Frau nickte.
Ein Elekromagnetischer Puls war ein kurzfristiger, hochenergetischer Spannungsausgleich. Das Phänomen trat bei Blitzeinschlägen oder einer Nuklearexplosion auf.
Andy überlegte daher mit einer gewissen Berechtigung, ob die junge Frau, die ihm gegenüber saß den Verstand verloren hatte.
Die Frau hatte einen Rucksack dabei. Er stand auf dem Stuhl neben ihr. Sie öffnete ihn. In ihm befand sich eine Apparatur, die Andy an eine Teslaspule erinnerte.
»Ist es das, was ich vermute, was es ist?« fragte Andy.
»Yep.« erwiderte die Frau kurz.
»Sie wollen doch nicht …« begann Andy.
»Doch.« sagte die Frau. »Ich will.« Sie drückte ein Taste auf der Apparatur. Augenblicklich wurde Andys MacBook dunkel. Überall im Café fiel das Licht aus. Aus einigen der WLAN-Router an den Wänden sprühten Funken, als der elektromagnetische Puls die empfindlichen Chips in ihrem Inneren röstete. Die Kellnerin schrie vor Schreck auf. Andy erfasste plötzlich ein Schwindelgefühl.
»Was haben sie getan?« fragte Andy.
»Ich muss dafür sorgen, dass ›Mutter‹ ihre Spur verliert. Dazu habe ich das drahtlose Netzwerk im Umkreis von zwei Blocks mittels eines EMP ausgeschaltet.«
»Nein. Ich meine, warum ist mir so schwindelig?«
Andy versuchte sich aufzusetzen, ließ es aber gleich wieder bleiben.
»Oh, das ist nur das Flunitrazepam, was ich ihnen in den Kaffee geschüttet habe.«
Andy versuchte erneut aufzustehen. Die Frau sprang auf und stützte ihn. Sie legte ein paar Dollarnoten auf den Tisch, warf sich den Rucksack über die Schulter und bugsierte Andy aus dem Café.
»Meinem Onkel ist schlecht geworden. Ich bringe ihn in ein Krankenhaus.« erklärte die Frau der Kellnerin, die ratlos vor einem offenen Sicherungskasten hinter dem Tresen stand.
»Machen sie das.« jammerte die Kellnerin abwesend. »Noch nicht einmal das Telefon funktioniert mehr.«
Draussen durchwühlte die Frau Andys Taschen und fand seinen Autoschlüssel. Beim Wagen angekommen öffnete sie die Beifahrertür mit dem Schlüssel und half Andy auf den Beifahrersitz.
»Wo … bringen sie mich … hin?« murmelte Andy.
»Ich bringe sie zu meinem Boss.« erklärte die Frau.
»Name?«
»Darf ich nicht verraten.«
»Nein … ihr … Name.«
»Lisa Arnold, Mr. Curkow. Weltbeste Hackerin.«
»Lisa …« murmelte Andy noch. Dann verlor er endgültig das Bewusstsein.
Als Andy wieder zu sich kam, saß er allein in seinem alten Crown Victoria auf dem Beifahrersitz. Das Autoradio spielte leise Stevie Wonders Superstition.
Andys Wange klebte am Seitenfenster. Er versuchte sich zu bewegen, doch er musste feststellen, dass seine Hände und Füße mit Kabelbinder gefesselt waren. Mühsam versuchte er seine Lage zu verändern. Sein Körper protestierte mit stechenden Schmerzen in Nacken, Rücken und den Beinen. Er musste sich bereits seit Stunden in dieser Lage befinden. Seine Beine begannen zu kribbeln, als durch die Bewegung das Blut in ihnen wieder zu zirkulieren begann.
Andy war kein Leichtgewicht und er hatte Bluthochdruck. Aus diesem Grund hatte sein Arzt ihm empfohlen Langstreckenflüge nach Möglichkeit zu vermeiden oder zumindest sich während eines solchen Fluges ausreichend zu bewegen. Es bestand immer die Gefahr, dass sich ein Blutgerinnsel in seinen Beinvenen bildete und eine Lungenembolie auslöste. Stundenlang gefesselt herumzusitzen war für seine Gesundheit also nicht gerade förderlich.
»Gottverdammt.« krächzte er. Er versuchte sich zu erinnern, was geschehen war:
Recherche. Hunger. Frühstück im Panera Bread. Schreiben. Junge Frau. Tesla-Spule. EMP. Droge im Kaffee und nun … Entführung. Nicht gerade ein üblicher Tag im Leben des allseits beliebten Technikjournalisten.
»Gottverdammt« wiederholte er keuchend. »Gott-Ver-dammt!« Niemand hörte sein Hadern mit den höheren Mächten.
Leichter Regen trommelte auf das Wagendach. Durch seinen Atem waren die Scheiben beschlagen. Mühsam wischte Andy ein Stück der Seitenscheibe frei.
Der Wagen parkte am Rand einer verlassen Straße in einem heruntergekommen Industriegebiet.
Andy seufzte. Er konnte sich praktisch überall befinden.
Angestrengt sah er sich weiter um. Es musste doch selbst in einer so verlassenen Gegend wie dieser ab und zu jemand vorbeikommen.
Dann sah er die junge Frau.
Lisa. Ihr Name ist Lisa Arnold. Weltbeste Hackerin, dachte Andy.
Lisa Arnold stand vor einer langgezogenen Backsteinmauer und hielt ein altertümliches Mobiltelefon in der Hand. Zumindest war es so groß, dass Andy es aus dieser Entfernung eindeutig identifizieren und als ein Mobiltelefon erkennen konnte. Es war ein altes Nokia-Modell. Vermutlich ein 8110, ein beliebtes Hacker-Telefon in den späten 90er Jahren.
Was zum Teufel macht sie damit?, dachte Andy und vergass für einen Moment seine kribbelnden Beine. Lisa steckte ein Kabel in das Ende des Telefons. Das andere Ende des Kabels verband sie … mit der Backsteinmauer. Zumindest sah es von Andys Position so aus.
Sie ist verrückt. Vollkommen durchgeknallt. Ich bin in die Hände einer vollkommen durchgeknallten Verrückten geraten!
Lisa starrte auf das Telefon. Dann nickte sie zufrieden, zog das Kabel aus der Backsteinmauer und dem Telefon und stopfte es in eine Tasche ihrer Lederjacke.
Dann kehrte sie zum Wagen zurück. Dabei hielt sie das Telefon vor sich und sprach hinein, als ob sie damit ein Gespräch über Lautsprecher führte.
Sie lachte fröhlich. Wer auch immer aus dem Telefon zu der jungen Frau sprach - sie musste ihn sehr mögen.
In was für eine Bantha-Kacke bin ich hier nur hineingeraten?, dachte Andy.
Lisa stieg auf der Fahrerseite ein. Sie setzte das altmodische Mobiltelefon in eine Ladeschale am Armaturenbrett, die von ihr in den Stunden seiner Bewusstlosigkeit installiert worden sein musste.
Auf dem in grün leuchtendem Display sah man ein einzelnes, großes Emoticon.
Es schien zu sprechen.
»Wake Up Call.«, tönte es blechern aus dem Telefon.
Lisa sah vom Telefon zu Andy.
»Oh, sie sind wach.« sagte sie knapp.
»Machen … machen sie mich los.« krächzte Andy.
»Nope.« sagte Lisa und zückte eine Impfpistole.
»Nein! Tun sie das nicht!« flehte Andy.
»Blame It On The Sun.«, bemerkte die Stimme aus dem Telefon.
»Richtig, Phil.« pflichtete Lisa Arnold der Stimme aus dem Telefon bei.
Ein lähmende Müdigkeit erfasste Andys Körper und er verlor zum wiederholtem Mal an diesem wohl nie enden wollenden Tag das Bewusstsein.
Andy hörte zuerst das leise Schlagen von Wellen. Dann das entfernte Kreischen von Möwen. Langsam öffnete er die Augen. Er lag rücklings auf einer hölzernen Liege und starrte auf eine mit hellem Holz vertäfelte Decke. Wasserreflexionen krochen auf ihr umher wie eine aufgeschreckte Herde von Zebras.
Wo bin ich? dachte er, immer noch benommen.
Wo immer er sich befand … Es roch nach Wald und Meer.
Er drehte seinen Kopf und starrte auf eine ruhige, blaugraue See deren Licht durch große, rahmenlose Fenster in den Raum flutete.
Der Raum war bis auf die Liege und einen Holzstuhl mit Armlehnen vollkommen leer.
Auf dem Stuhl saß eine der schönsten Frauen des uns bekannten Universums in einem schlichten Kostüm und sah darin atemberaubend aus. »Guten Morgen, Mister Curkow.«
Andy sagte nichts. Zunächst überprüfte er den Zustand seiner Kleidung. Sein geliebter Hut befand sich nicht auf seinem Kopf und seine Kleidung war durch einen bequemen Bademantel ersetzt worden.
In nahezu jedem anderen denkbaren Szenario der vergangenen Stunden wäre Andy peinlich berührt gewesen Katherine ›Die Göttin‹ Williams nur in einem Bademantel bekleidet gegenüberzutreten.
Doch Andy hatte in dieser kurzen Zeitspanne bereits genug Peinlichkeiten für ein halbes Leben erlitten und war daher einfach nur sauer.
»Nennen sie mich Andy.« knurrte er. »Da sie mich unter Einsatz von Gewalt entführen ließen, können wir auf die üblichen Formen von Höflichkeit wohl verzichten.«
Katherine Williams sagte nichts. Stattdessen zauberte sie von irgendwo eine Zigarette her und steckte sich diese mit einem ebenso plötzlich in ihrer Hand erschienen, goldenen Gas-Feuerzeug an.
»Würden sie die Güte haben nicht zu rauchen?« fragte Andy.
»Das ist keine echte Zigarette, Andy.« sagte Katherine Williams ruhig und blies den angeblich unechten Zigarettenqualm in seine Richtung. Dann blickte sie hinaus auf die See. »Andy …« sagte sie dann. »Mein letzter Ehe-Mann heisst Andy.«
»Wundert mich nicht.« sagte Andy.
»Wie bitte?«
»Wenn sie meinen Namensvetter so behandelt haben, wie mich, dann kann ich gut verstehen, dass er sie verlassen hat - schönste Frau der Welt hin oder her.«
Katherine William lächelte. »Nein. Das war nicht der Grund unserer Trennung, Andy.«
»Was war es dann?«
»Jemand hat mir eine Aufgabe übertragen, und dieser Aufgabe musste ich mich stellen. Und um meinen Mann nicht in Gefahr zu bringen, habe ich mich von ihm getrennt.«
»Hmh.« machte Andy. »Was für eine Aufgabe?« fragte er dann.
»Dazu komme ich gleich.«
»Und wer hat ihnen diese Aufgabe gestellt?«
Andy war sich fast sicher, dass Katherine Williams so etwas wie ›Gott‹ sagen würde. Viele Verrückte die sich gern mit weiteren Verrückten umgaben nannten als ›Auftraggeber‹ für ihre noch verrückteren Taten gern eine höhere Macht.
Doch Katherine Williams sagte nicht ›Gott‹.
Auf die Frage, welcher Auftraggeber ihr diese ominöse Aufgabe gestellt hatte, sagte sie:
»Es war das ›Mütterchen‹.«
Katherine Williams sagte: ›Mütterchen‹. Nicht ›Mutter‹ oder ›Mum‹. Sie sagte explizit ›Mütterchen‹. Eine interessante Wortwahl, wie Andy fand. Er unterdrückte jedoch seine Neugier und kommentierte nur mit einem knappen: »Aha.«
Wieder setzte Katherine Williams ihr entwaffnendes Lächeln auf. Es wirkte echt. Lernte man so etwas auf der Supermodel-Schule? dachte Andy.
»Nein.« erklärte die Williams.
»Wie bitte?« fragte Andy laut. Und in Gedanken fügte er hinzu: Konnte sie etwa meine Gedanken lesen?
»In diesem Raum schon.«
Andy setzte sich ruckartig auf.
»Sie verarschen mich, Lady.«
»Nein, Andy. Ich verarsche sie nicht.« erklärte die Williams ruhig.
»Dieser Raum ist ein virtuelles Konstrukt. Unsere Unterhaltung findet via Datenleitung statt.«
»Das ist vollkommen unmöglich.« stieß Andy hervor.
»Als Technologie-Journalist sollte ihnen doch eigentlich klar sein, dass das Auslesen und Identifizieren von Gedanken mittels eines Gehirn-Scans mit einer gewissen Fehlertoleranz bereits im Bereich des Möglichen liegt. Meine Ingenieure haben diese Methode nur verfeinert. Mittels dieser Technik kann ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ihre Gedanken interpretieren und lesen.«
»Oh-kay …« sagte Andy gedehnt und rieb sich die Augen. »Nehmen wir an, sie habe recht. Aber wie kann dann dies hier …« - er klopfte auf die hölzerne Liege - »Eine Illusion sein? Meiner Kenntnis nach, existiert so etwas wie ein Holo-Deck noch nicht.«
»Das muss es auch nicht.« erwiderte Katherine Williams. Sie zündete sich eine neue, angeblich ›virtuelle‹, Zigarette an.
»Jahrelang haben wir mittels sweepr.net von Millionen von Nutzern Milliarden von Informationen gesammelt und diese sicher für unsere Kunden verwahrt. Dies ist auch heute noch das Kerngeschäft von sweepr.net, so wie es mein verstorbener Mann Richard Baxter damals begründet hat. Doch wir müssen uns neu orientieren. Die Konkurrenz schläft nicht. Google und Apple arbeiten zur Zeit an ähnlichen Innovationen. Daher haben wir uns bei sweepr.net überlegt, wie man dieses gigantische Feld voller reifer Informationen sinnvoll ernten und in lukrative Produkte überführen kann.«
Die Williams war nun ganz Geschäftsfrau. Andy hatte nun mehr das Gefühl einer Firmenpräsentation zu lauschen.
»Und was für einen Ertrag hat ihre Ernte ergeben?« fragte Andy.
»Zunächst haben wir ein System entwickelt, dass die Geheimnisse unserer Kunden anonymisiert filtert und nach Gemeinsamkeiten durchsucht. Mittels dieser Daten haben wir ein Programm entwickelt, dass die geheime Wünsche und Sehnsüchte - im Grunde also die Emotionen - die zum Beispiel bei der Rezeption eines Spielfilms auftreten mittels Nanobots als Nervenimpulse im Gehirn repliziert.
»Nein. Das ist vollkommen unmöglich.«
»Warum? Das Programm muss nicht wissen, dass etwas real ist. Es muss auch nicht wissen, was eine Emotion ist. Sie als Anwender müssen es nur als eine solche wahrnehmen. Jahrelang hat man in der Simulations-Technik nur versucht die basalen Sinneswahrnehmungen ohne die emotionalen Verknüpfungen umzusetzen. Doch das, was die Realität um sie herum zur Realität werden lässt, sind neben ihren Sinneseindrücken vor allem ihre gespeicherten Empfindungen, die sie mit dieser aus ihren Sinneseindrücken erlebten Realität abgleichen. Statt dieser Realität gleichen wir mittels unseres Programms und den Nanobots nun unsere künstliche Wirklichkeit mit ihren gespeicherten Empfindungen ab. Das ist eigentlich alles.«
»Das klingt … unglaublich.«
»Dies hier …« ihre langen und schmalen Finger umfassten den Raum, »… ist eine recht einfache künstliche Wirklichkeit. Vielleicht kann sie eine etwas komplexere Simulation eher von meinen Worten und den Möglichkeiten des Streams überzeugen.«
»Ich weiß nicht, ob ich …«
Weiter kam Andy nicht, denn plötzlich spürte er keinen Boden mehr unter den Füßen.
Andy schwebte … Nein. Er flog durch die klare, kalte Bergluft … Vor ihm das gemalte Abbild eines Berges, dessen Kuppe entfernt an das Matterhorn erinnerte. Andy kannte diesen Berg. Jedes Kind kannte diesen Berg. Es war der Berg aus dem Logo der Paramount Pictures Filmproduktionsgesellschaft.
Wie um Andy zu belohnen, erschien prompt vor dem Berg der Schriftzug:
A Paramount Picture
A Gulf + Western Company
Er war umkränzt von vierundzwanzig Sternen. Dann veränderte sich die Szenerie. Der Himmel wurde dunkler, nahm die Farbe von Eisen an. Das Abbild des Berges wölbte sich Andy entgegen, wurde zum Relief.
Große, rote Lettern verkündeten:
Paramount Pictures Presents
Langsam entfernte sich Andy von dem in Eisen getriebenen Berg.
Der Eisenhimmel entpuppte sich als kreisrunde Scheibe.
Andy erkannte nun, dass es sich um einen mächtigen, mannshohen Gong handelte. Ein grimmig dreinblickender, muskelbepackter Asiate mit nacktem Oberkörper stand rechts neben dem Ungetüm, und schwang einen großen Klöppel. Er schlug den Gong dreimal und dann schwenkte Andys Blickwinkel nach links zu einer kleinen Bühne.
Aus dem dampfenden, rotglühenden Maul eines weißen Drachenkopfs trat Revuestar Willie Scott, gespielt von Kate Capshaw hervor, der späteren Frau von Steven Spielberg. Sie trug ein glitzerndes, hautenges Paillettenkleid in Rot und Gold.
Ein Chor ertönte. Willie Scott hob die Arme und Andy wurde darüber informiert, dass Harrison Ford der Star in diesem Film war. Der Titel des Films erschien in großen Lettern hinter der Scott:
Indiana Jones und der Tempel des Todes
Dann begann Willie Scott zu singen. Auf kantonesisch.
»Yi wang si-i wa ye kan dao - Xin li bian yao la jing bao jin tian zhi dao … Anything goes.«
Plötzlich fuhr die Kamera zurück. Andy, der den zweiten Teil der ›Indiana Jones‹-Reihe bestimmt vier dutzend Mal in seinem Leben gesehen hatte, wusste, dass diese Kamerabewegung nicht in den Film gehörte.
Doch dies war kein Film. Dies hier war eine quasi-religiöse Erfahrung.
Die Kamera hielt an einem der runden Tische inne und plötzlich wusste Andy, dass er die Welt von Indiana Jones nicht nur als Zuschauer erlebte, sondern wirklich in ihr war.
Er bewegte den Kopf und die virtuelle Kamera bewegte sich ebenfalls. Er sah hinab und sah seine Hände und Arme. Sie steckten in einem Smoking.
Gegenüber am Tisch saß Lao Che, der chinesische Gangsterboss, flankiert von seinen beiden Söhnen Kao Kan und Chen. Amüsiert genossen sie die Darbietung von Willie Scott.
Andy drehte den Kopf. Neben ihm am Tisch saß Katherine Williams. Sie steckte in einem Hosenanzug, wie ihn Marlene Dietrich in dem Film Marokko getragen hatte und trug eine Fingerwellen-Frisur. In der Hand hielt sie eine lange schwarze Zigarettenspitze, an deren Ende eine asiatische Kräuterzigarette steckte.
Andy konnte den Rauch riechen. Das süß-herbe Parfüm der Williams. Den duftenden Reis der am Nebentisch serviert wurde. Den Geruch des künstlichen Nebels mit deren Hilfe die Bühnentechniker den dampfenden Atem des Drachen simulierten.
Die Simulation in einer Simulation, dachte er.
»Nun, wie finden sie es?« fragte die Williams keck und mit einem leichten deutschen Akzent, der die Ähnlichkeit ihrer Erscheinung mit der der Dietrich noch unterstrich. Sie musste ein wenig lauter sprechen, da Wille Scott immer noch auf der Bühne sang.
Andy konnte nur mit offenem Mund nicken. Er brachte keinen Ton heraus. Seine Kehle war staubtrocken. Er griff sich eine flache Schaumweinschale und wollte es gierig herunterstürzen.
Katherine Williams Augen wurden schmal.
»Das würde ich nicht tun.« sagte sie und so plötzlich wie er sich in der künstlichen Welt des Nachtclubs Obi-Wan in Shanghai aus dem Jahr 1936 befunden hatte …
… so plötzlich war er wieder zurück.
Doch Andy befand sich nicht mehr auf der hölzernen Liege in dem Raum mit der breiten Fensterfront. Der Raum in dem er sich nun wiederfand war kleiner und hatte kahle Wände. Fahles, kaltes Licht von nackten Neonröhren blendete ihn. Er lag auf einer harten Liege, die dem Stuhl eines Zahnarztes glich. Auf seiner Stirn klebten Drähte die in einen summenden Apparat, irgendwo hinter ihm führten. Seine Hände und Füße waren mit Lederriemen gefesselt.
Ich bin der Marathon-Mann, dachte Andy. Dabei war seine körperliche Fitness weit davon entfernt einen Marathon zu überstehen. Aber in dieser hilflosen Lage musste er unweigerlich an die unglückliche Filmfigur Thomas ›Babe‹ Levy denken, die in dem Film ›Der Marathon-Mann‹ in einem ähnlichen Stuhl, in einem ähnlichen Raum, von einem grausamen KZ-Zahnarzt gefoltert worden war.
Ein Schatten schob sich vor das Neonlicht. Andy blinzelte.
Es war nicht Laurence Olivier als der KZ-Arzt Szell. Es war Katherine Williams. Immer noch schön, aber mit einer weniger atemberaubenden Aura … weniger Zauber. Ihre Haut wirkte blasser, ihre Augen wirkten müde und in den Augenwinkeln sah man kleine Fältchen. Andy musste an ein blasses Steak denken, dass unter dem Rotlicht der Metzger-Theke noch frisch und rosig ausgesehen hatte, bei Tageslicht jedoch blass und alt wirkte. Auf Katherines Stirn klebten ebenfalls Drähte an Elektroden. Sie zog sie mit einem ›Plopp‹ ab. Dann befreite sie Andy Hände von den Riemen und reichte ihm ein Glas Wasser.
Als Andy nicht reagierte, sagte sie: »Eben im Stream hatten sie noch Durst. Trinken Sie.«
Andy versuchte sich aufzusetzen. Es gelang ihm nicht.
»Warten sie.« sagte die Williams und betätigte irgendwo am Stuhl eine Taste. Daraufhin hob sich die Rückenlehne des Stuhls. Andy ergriff das Glas mit zitternden Händen. Er kaute das Wasser mehr, als das er es trank. Danach fühlte er sich besser. Er sah sich um. Rechts neben ihm befand sich ein identischer Stuhl mit Lederriemen und einer Halterung für Elektroden. Dort hatte wohl bis eben Katherine Williams gelegen. An der Wand stand eine Werkbank angefüllt mit elektronischen Bauteilen. An der Werkbank lehnte die junge Frau, Lisa Arnold. Sie musterte ihn mit verschränkten Armen.
Ihr altmodisches Telefon klemmte in einer Hülle mit Fenster am Revers ihrer Lederjacke und schien Andy interessierter zu mustern, als dessen Besitzerin.
»Hey.« sagte diese nur zur Begrüßung.
»Hey.«, erwiderte Andy heiser. Dann wandte er sich wieder an Katherine Williams. »Warum durfte ich im … im Stream nicht den Champagner trinken?«
»Das war das Glas mit dem Lao Che im Film Indiana Jones vergiftet. Da der Stream den Film genau abbildet, hätten sie in ihrer Vorstellung die Auswirkungen des Giftes ebenso gespürt wie die Figur des Helden im Film.«
»Das heisst, wenn sie mich statt in ›Indiana Jones‹ in ›Der Soldat James Ryan‹ auf den Strand in die Normandie geschickt hätten, wäre eine Filmkugel oder eine Granate in der Lage gewesen mich zu töten?«
»Wenn sie wirklich glauben würden, dass sie tödlich getroffen wären … ja. Bedenken sie, Andy: Der Glaube kann Berge versetzen.«
Andy versuchte immer noch die Eindrücke seiner Erfahrung mit dieser neuen Technologie zu begreifen.
»Unglaublich.« flüsterte er . Katherine nickte ernst. »Ich hätte sie nie einer echten Gefahr ausgesetzt, Andy. Man kann in den Stream auch einfach nur eintauchen, wie ein Geist. Dann folgen sie der Handlung so, wie sie ihr in einem Film folgen würden. Aber ich wollte ihnen die Möglichkeiten dieser unglaublichen Technologie aufzeigen. Können sie sich vorstellen, welche Auswirkungen dieses neue Medium auf die Welt haben wird?«
Andy überlegte eine Weile. »Ehrlich gesagt … Nein. Und ich glaube, dass sie und ihre Kleine hier, es auch nicht wissen.« Er hob die Beine von der Liege und riss sich die Elektroden von der Stirn.
»Danke für die Entführung und den virtuellen Trip. Ich würde nun gern wieder nach Haus gebracht werden. Wenn möglich ohne Betäubung.« Katherine grinste. Es war ein freundliches Grinsen aber dennoch steckte auch eine Spur von Triumph darin. Es galt Lisa Arnold. Diese hob abwehrend die Arme:
»Okay, okay. Sie hatten recht. Er ist nicht so dumm, wie er aussieht.«
Das machte Andy wütend. Er war ein sehr ausgeglichener Mann, aber wenn man ihn einmal in Rage brachte, dann war nicht mit ihm zu spaßen. »Was zum Teufel ist los mit ihnen?!« rief er. Nein. Er schrie. »Glauben sie wirklich, nur weil sie mit ihrem Supermodel-Hintern zufälligerweise auf ein paar Milliarden Dollar und mehr Geheimnissen über Amerika als J. Edgar Hoover sitzen, können sie einen Journalisten so einfach entführen, bedrohen, in Kellergewölben an Stühle fesseln und noch glauben damit durchzukommen?! Noch sind wir hier in den Vereinigten Statten von Amerika, verdammt nochmal! Auch wenn dieses Land in einer tiefen Krise steckt … Auch wenn die Zeitungsverlage in einer Krise stecken - Noch werden ein paar davon gedruckt. Und in meiner nächsten Kolumne des National Inquisitors werden erst einmal 250.000 Leser darüber aufgeklärt, wem sie da eigentlich ihre intimsten Daten anvertrauen, darauf können sie einen lassen, Lady!«
Katherine Williams hatte während seiner Tirade die Hände gefaltet und an den Mund gelegt. Nun sah sie ihn ernst an.
»Dieses Land steckt in der Tat in einer tiefen Krise, Andy. Die ganze Welt steckt in einer tiefen Krise. Aber die Lage ist noch viel schlimmer als sie glauben, Andy. Sehr viel schlimmer. Die Art, wie sie von Lisa Arnold behandelt wurden tut mir aufrichtig leid. Doch das war nötig. Es war äußerst wichtig sie unbemerkt hierher zu schaffen. Ihr Leben hängt davon ab.«
»Mein Leben?« fragte Andy. »Der einzige Mensch, der mir in letzter Zeit nach dem Leben getrachtet hat, war ihre kleine Hackerin hier.«
»Meine Name ist Lisa.« sagte die junge Frau kühl. »Und wenn ich sie hätte umbringen wollen, dann wären sie jetzt tot, sie Fettwanst.«
»Es reicht, Lisa.« sagte Katherine Williams scharf. »Danke für deine Hilfe. Du kannst jetzt gehen. Ich werde mich mit Mister Curkow weiter allein unterhalten.«
Lisa blies sich wütend ein Haarlocke aus der Stirn und stolzierte zum Ausgang des Raums. Es war eine keine Tür, sondern eine stählerne Luke mit einem Drehrad, wie man sie wohl auf einem Schiff oder U-Boot fand.
Lisa drehte das Rad, öffnete die Luke, trat hindurch und schlug sie dann mit Wucht von der anderen Seite zu. Das Geräusch erinnerte Andy an den Gong aus dem Club Obi-Wan.
Katherine Williams wandte sich wieder zu Andy:
»Haben sie vielleicht Hunger?«
Es gab Steak zum Abendessen. Es war gut, doch Andy rührte seinen Teller kaum an. Er war viel zu wütend, um etwas essen zu können. Und das - seine Withings Badezimmerwaage mit Twitter-Anschluß, sein Kühlschrank und sein Lieblings-Donut-Shop konnten dies bezeugen - war ein äußerst seltener Zustand.
»Schmeckt es ihnen nicht, Andy?« fragte Katherine über den langen, schmalen Tisch hinweg. »Das ist Kobe-Rind. Sehr gut und sehr teuer.« Andy hatte von Kobe-Rind gehört. Die Tiere bekamen Bier zu trinken und wurde im Stall massiert - bevor sie geschlachtet wurden.
Andy konnte sich der Ironie nicht erwehren: Dieses Rind war von Katherine Williams wohl mit größerem Respekt behandelt worden als er selbst. Mehr aus Neugier schnitt er ein Stück ab und steckte es in den Mund. Es zerschmolz fast wie Butter auf seiner Zunge. Gierig und ohne groß darüber nachzudenken, verspeiste Andy fast die Hälfte des Steaks. Katherine Williams lächelte. »So ist es besser, oder nicht? Ein Trip in den Stream macht sehr hungrig. Es ist ein bisschen wie der Hungerflash nach einem Joint.«
Irgendwie brachte diese Bemerkung Andy dazu das Besteck hinzulegen und den Teller von sich zu schieben.
»Sie sind gewohnt immer alles zu bekommen, was sie wollen, Miss Williams, ist es nicht so?«
Katherine Williams faltete die Hände zusammen und schien darüber nachzudenken. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, ich bin keineswegs daran gewöhnt. Aber im Augenblick ist es sehr hilfreich, um einen Krieg zu gewinnen, den ich nicht begonnen habe, der aber nun zu meiner Lebensaufgabe geworden ist.«
»Von was für einem Krieg sprechen sie da? Ich bin ein einfacher Junge aus Boston, ich verstehe diese martialische Silicon Valley Rhetorik nicht.«
»Ich spreche hier nicht mit wirtschaftlicher Kriegsmetaphorik, Andy. Ich spreche von einem echten, realen Krieg in dem Menschen sterben.«
Andy musste schlucken. Er versuchte zu begreifen, worauf die Williams mit ihren Ausführungen hinauswollte.
»Das sie sich in einem Atombomben sicheren Bunker verstecken und glauben Mädchen dazu anstiften zu müssen harmlose Technikjournalisten gewaltsam zu entführen, hat mit dieser Stream-Technologie zu tun, richtig?«
Katherine Williams nickte. Nur weiter.
»Ich vermute mal, dass eine solche Technologie, die darauf basiert, dass sie Informationen mit Emotionen koppelt und in einen für menschliche Empfindungen nachvollziehbaren Sinnzusammenhang bringt ein ziemlich komplexes, adaptives System darstellt, richtig?«
Andys Augen wurden groß. Katherine Williams starrte ihn an, unterbrach ihn aber nicht. Sie wusste, er hatte es.
»Und dieses komplexe, adaptive System muss so etwas wie ein rudimentäres Bewusstsein entwickeln haben! Deshalb dieses Versteck hier. Sie verstecken sich vor dieser … dieser künstlichen Intelligenz!«
»So ist es.«
»Aber was habe ich damit zu tun, dass sie von ihrer eigenen Datenbank voller schmutziger Geheimnisse und Gefühle gestalkt werden?«
Katherine Williams seufzte, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Wie sie vielleicht wissen wurde ich vor ein paar Jahren von einem Serienkiller namens Parker Daley verfolgt und fast getötet.«
Andy wurde rot. Er kannte natürlich den Fall. Der von den Medien ›Catwalk-Killer‹ getaufte Parker Daley hatte sechs der sieben Supermodels, die in den 90ern nur als die ›Magnificent Seven‹ bekannt gewesen waren, brutal ermordet. Nur Katherine Williams überlebte den Angriff des verrückten Killers Dank der New Yorker Polizistin Helen Louisiani, die dabei ihren Partner verlor. Es war also zu verständlich, dass Katherine Williams es nicht schätzte von einem ›Stalker‹ verfolgt zu werden, ob nun Serienkiller, oder Künstliche Intelligenz.
»Wie ich sehe, kennen sie die Geschichte. Ich habe damals viele Menschen verloren die ich liebte. Und wie sie vielleicht auch wissen, musste ich einige Jahre zuvor den Verlust meines Mannes und …« Sie machte eine kleine Pause und biss sich leicht auf die Lippen. »… und meines Sohnes durch ein Flugzeugabsturz hinnehmen. Ich überlebte den Absturz mit schweren Verbrennungen. Durch die Beziehungen meines Vaters, Senator Williams, wurde ich ein Testobjekt für ein geheimes, militärisches Projekt mit Namen ›Lazarus‹. Nach der Behandlung waren meine äußeren Narben verschwunden.«
Andy blickte betroffen auf seinen Teller. Äußere Narben hat sie gesagt. Sie mochte eine der schönsten Frauen auf dem Planeten sein, doch die Verletzungen in ihrem Inneren waren dafür ein hoher Preis. Katherine Williams fuhr fort:
»Wie sich später in einem Untersuchungsausschuss herausstellte, hatte die verantwortliche Projektleiterin des Pentagon, Ashera Arnold, verbotener Weise das Projekt ›Lazarus‹ mit zum Tode verurteilten Straftätern durchgeführt.
Ich erhielt eine neue, künstlich reproduzierte Haut, die aber auf dem genetischen Profil von Parker Daleys Haut beruhte. Obwohl Parker Daley später selbst als Ersatz eine neue Haut bekam, gab er mir die Schuld für den Verlust seiner eigenen - und beschloss die Haut meiner Kolleginnen vom Laufsteg als Opfer für einen Ritus der Azteken zu verwenden, um sich im Anschluss durch meinen Tod und die Vereinigung mit meiner Leiche mittels göttlicher Energie zu erneuern.«
Sie lachte leise. Es war ein raues, kehliges Lachen.
»In diesem Szenario eines vollkommen Verrückten war es nicht gerade hilfreich, dass die Presse mich nur ›Die Göttin‹ nannte.« Sie lächelte gequält. »Aber ich habe überlebt. Ich habe einen neuen Mann kennen gelernt, oder besser: Ich habe mich erneut in meine erste große Liebe verliebt und mit ihm zwei wunderbare Kinder bekommen. Ich dachte wirklich, ich hätte es geschafft. Ich …«
Sie zögerte. »Ich glaubte den inneren Schmerz, den ich seit meiner Zeit als Model mit mir herumschleppte endgültig bezwungen zu haben.« Katherine stützte ihre Arme mit den Ellenbogen auf den Tisch und faltete ihre schmalen Hände zu einer Faust zusammen. Damit klopfte sie leise auf den Tisch.
»Doch die Geister der Vergangenheit haben mich nun wieder eingeholt, Andy. Mein Erbe, sweepr.net die Firma meines geliebten Richard hat einen Geist aus seiner Flasche gelassen, den ich nun wieder hineinstopfen muss. Und dieser Geist ist für die Welt wesentlich gefährlicher, als es Parker Daley je war.« Sie machte ein Pause, da Andy sie nur verständnislos anstarrte: »Also schön. Ich erzähle von Anfang an: Es begann vor sechs Wochen mit einem Anruf meines CTO.«
Katherine saß im Firmen-Helikopter und döste. Ein langer Tag lag hinter ihr. Im Rahmen der Technologie-Konferenz ›Interop‹ in New York hatte sie den ganzen Tag über hinter verschlossenen Türen Gespräche mit potentiellen Partnern für eine Vermarktung des neuen ›Stream‹ Angebots von sweepr.net geführt. Katherine hatte fruchtbare Gespräche geführt. Sie war optimistisch im kommenden Frühjahr ein Produkt vorstellen zu können - ohne das Google, Facebook oder Apple zuvor Wind davon bekommen würden.
Katherines Kopf lehnte am Kunststofffenster der Seitenluke des Helikopters. Unter ihr floss in zähen Lichtspuren der Verkehr der Route 40. Ein Knacken in ihrem Kopfhörer ließ Katherine den Kopf heben. Bill, der Pilot meldete sich:
»Mam?«
»Was gibt’s, Bill?«
»Ich habe hier Mr. Arnsberg in der Leitung für sie.«
»Robert?« fragte Katherine leise. »In Ordnung. Stellen sie durch, Bill.«
Wieder ein Knacken, dann hörte sie die Stimme von Robert Arnsberg, dem technische Leiter von sweepr.net. Roberts Stimme wurde durch den Kopfhörer verzerrt, dennoch schwang darin Müdigkeit mit. Und dann noch etwas, was Katherine sofort veranlasste sich aufzurichten: Angst.
»Ähm … Katherine, wir … wir haben ein Problem.«
»Was ist los Rob?«
»Ich weiß noch nicht wie, aber wir haben die Verbindung zu unserem Datacenter in North Carolina verloren.«
»Was meinst du damit, die Verbindung verloren? Was sagt der Webmaster in Maiden?«
»Das ist eines der Probleme. Es sind nicht nur unsere Datenleitungen betroffen, sondern auch die Kommunikation mit unseren Mitarbeitern vor Ort.«
»Wie kann das sein? Was ist mit der Security? Maintenance? Der Putzfrau, Herr Gott, irgendjemand?!«
»Wir wissen es nicht.« erklärte Arnsberg.
Katherine rieb sich müde die Augen. »Verständigen sie die lokale Polizei. Sie soll mal nach dem rechten sehen.«
»Schon geschehen. In etwa zehn Minuten sind sie vor Ort. Ich könnte eine Observation durch einen Satelliten veranlassen, dass ist aber nicht ganz billig.«
Arnsberg war jemand, der mitdachte. Das war einer der Gründe warum Katherine ihn zum CTO ernannt hatte.
»Gute Idee. Machen sie es so.«
»Ich bin selbst gerade auf dem Weg nach Maiden und werde in circa zwei Stunden dort eintreffen. Sie sind auf den Weg zu ihrem Anwesen in St. Michaels?«
»Das bin ich.«
»Ich würde vorschlagen, sie bleiben vorerst dort. Ich melde mich dann, wenn ich vor Ort bin.«
»Verstanden.«
»Bis dann.« verabschiedete sich Robert Arnsberg.
»Das war das letzte Mal, das ich mit Robert Arnsberg gesprochen habe.« sagte Katherine und zündete sich eine Zigarre an. Mittlerweile saßen sie in einem kleinem Arbeitszimmer, das sich dem Esszimmer anschloss. Auch dieses Zimmer hatten sie durch eine Luke betreten. Das Zimmer enthielt einen altmodischen Eichenschreibtisch und ein paar Regale voller Bücher. Andy überflog die Buchrücken und stellte geschmeichelt fest, dass auch ein paar seiner Bücher darunter waren. Sie waren unter ›C‹ einsortiert. Unter ›L‹ fand Andy auch Steven Levys Buch ›Hackers‹. Es sah eindeutig gelesener aus als seine.
»Was haben sie gesagt?« fragte Andy abwesend. Levys offensichtlich größere Wertschätzung versetzte ihm einen kleinen Stich.
Katherine lächelte schüttelte leicht den Kopf und blies den Rauch der Monte Christo an die Decke.
»Ich habe in der Tat zunächst erwogen Steven Levy zu meinem Vorhaben hinzuzuziehen, Andy.«
»Er ist die logische Wahl.« sagte Andy und schob das Buch wieder ins Regal.
»Bitte entschuldigen sie. Sie sagten …?«
»… Das dies das letzte Mal war, dass ich Robert Arnsberg gesprochen habe.«
»Was meinen sie damit?« fragte Andy. Plötzlich spürte er, wie sich seine Kehle zusammenzog. Katherine bemerkte es und deutete auf einen der Sessel vor ihrem Schreibtisch. »Setzen sie sich Andy.«
Er tat wie geheißen. Katherine ließ einen dichten Ascheklumpen von der Spitze der Zigarre in einen Aschenbecher fallen.
»So wie ich es sage, Andy. Ich habe Robert Arnsberg noch einmal gesehen, aber nicht mehr gesprochen …« Sie machte eine Pause und zog tief an der Zigarre. »… denn zu diesem Zeitpunkt war er bereits tot.«
»Gottverdammt.« murmelte Andy, der eigentlich gelernt hatte in der Gegenwart einer Dame nicht zu fluchen. Er nahm einen großen Schluck von seinem Bourbon, den Katherine ihm zuvor eingeschenkt hatte. Katherine fuhr fort:
»Die Polizei von Maiden traf vor Robert am Rechenzentrum ein. Sie fanden einen Wachmann vor, der ihnen erklärte, dass sämtliche Kommunikationswege ausgefallen waren. Über das Mobiltelefon verständigte der Wachmann Arnsberg. Da keine akute Gefahr zu bestehen schien und das Problem wohl ausschließlich technischer Natur zu sein schien, entschloss die Polizei gemeinsam mit dem Wachmann auf Arnsbergs Ankunft zu warten.«
»Aber da war etwas faul, oder?«
»Nun, die Polizei ging zunächst nicht davon aus.«
Eine Stunde und vierundzwanzig Minuten nach dem Telefonat mit Katherine Williams landete Robert Arnsberg mit einem Hubschrauber auf dem Gelände des Rechenzentrums. Er wies den Piloten an wieder nach Hickory zu fliegen, da er bereits zu diesem Zeitpunkt davon ausging, dass die Probleme sich wohl nicht in ein paar Stunden lösen ließen.
Arnsberg führte bei solchen Einsätzen immer eine kleine Umhängetasche mit dem nötigsten mit sich.
Er fand einen der Golfkarren mit denen die Wachmannschaft das Gelände patrouillierte in einer der Ladestationen beim Hubschrauberlandeplatz, bestieg es und fuhr damit zum Haupttor. Dort angekommen wurde er von dem Wachmann begrüßt, der ihn über das Mobiltelefon des Sheriffs bereits über die Lage instruiert hatte. Der Wachmann war ein kleiner, schmaler Mann. Arnsberg warf einen schnellen Blick auf die ID-Karte. Der Wachmann hieß Mosley.
Arnsberg, der gut einen Kopf größer als Mosley war, schüttelte dem Wachmann zur Begrüßung die Hand. Der Händedruck war fest und deutete an, dass mit Mosley trotz seiner unscheinbaren Erscheinung nicht gut Kirschen essen war, wenn es darauf ankam.
Natürlich nicht, sonst hätten wir ihn ja nicht eingestellt, dachte er.
»Tja, Sir, da haben wir ein echt schlimmes Schlamassel.« sagte Mosley und deutete mit dem Daumen hinter sich auf das Rechenzentrum. »Im Moment läuft da gar nichts. Alle Eingänge sind hermetisch verriegelt.«
»Haben sie Kontakt zu ihren Leuten?«
»Negativ. Beide Teams haben gerade drinnen ihre Runden gemacht, als die Lichter ausgingen und die Notabschaltung den Laden dicht machte. Handysignale dringen weder raus noch rein und Intercom funktioniert nicht. Es scheint weder ein Feuer noch einen Wasserschaden gegeben zu haben. Die Sensoren haben zumindest vor der Abschaltung nichts dergleichen registriert.«
»Gibt es irgendeine andere Möglichkeit mit dem Personal Kontakt aufzunehmen?«
»Es gibt für den Notfall noch ein paar Funkgeräte im Sicherheitsraum, aber auf keinem der Kanäle meldet sich jemand.«
Arnsberg nickte. »Also schön, dann gehen wir rein.«
»Und?« fragte Andy heiser. »Was haben Arnsberg und der Wachmann im Inneren vorgefunden?«
»Sie sind Autor, Andy. Erlauben sie mir die Freiheit dieser traurigen Geschichte einen kleinen Spannungsbogen zu geben.«
»Möchten sie auch noch einen Bourbon?« fragte Katherine die aufgestanden war und sich selbst ein großes Glas einschenkte. Andy schüttelte den Kopf. »Nein, danke.« Er beobachtete mit einer Mischung aus Verwunderung und Missfallen, wie sie den Bourbon wie Apfelsaft herunterstürzte. Katherine bemerkte seinen Blick und lächelte. »Die genetisch veränderten Eigenschaften der Zellregeneration meiner neuen Haut sind über die Jahre auf meinen gesamten Organismus übergegangen. Das hat seine Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass ich vermutlich mit sechzig noch wie Ende dreißig aussehe werde. Ein Nachteil ist, dass mein Metabolismus jede Form von Giftstoff - also auch Alkohol - neutralisiert.«
»Wie bei Captain America und seinem Supersoldaten-Serum.« murmelte Andy.
»Was bitte?«
»Nichts. Bitte fahren sie fort.«
»Also gut. Bevor Arnsberg und der Wachmann ins Innere vordringen konnten, mussten sie zunächst die Sicherheitsschleuse passieren …«
Arnsberg und der Wachmann standen vor der Zugangsschleuse am Haupteingang zum Rechenzentrum.
Rechts neben der Schleuse war ein berührungsempfindlicher Bildschirm in die Wand eingelassen. Der Schirm zeigte folgende Grafik:
Der Handabdruck innerhalb des Kreises blinkte rot. Die darunter liegende Aufforderung des Bildschirms, seine gläserne Fläche zu berühren ließ Arnsberg an einen Fernsehprediger aus dem Bible Belt denken.
»Berühren sie den Bildschirm, und sie werden erlööööst werden!«
»Haben sie etwas gesagt?« fragte der Wachmann. Arnsberg sah ihn überrascht an. Er musste laut gedacht haben. Er schüttelte den Kopf und lachte leise. »Es ist nichts.« Arnsberg seufzte. Er fühlte sich unwohl. Er hatte schon dutzende Male Rechenzentren durch solche Schleusen betreten und hatte bereits eine Handvoll von Notabschaltungen erlebt. Zwei bei Google, eine bei Apple und nun war es also auch bei seinem jetzigen Arbeitgeber sweepr.net zu einem solchen Störfall gekommen. Alles keine große Sache. Wahrscheinlich waren ein paar Serverblades hin und ein paar SSDs über den Jordan gegangen. Aber dennoch … Irgendetwas war dieses Mal anders. Das Gebäude welches er sich nun anschickte zu betreten wirkte auf ihn irgendwie … feindselig.
»Alles in Ordnung, Sir?« fragte der Wachmann und riss Arnsberg aus seinen trüben Gedanken. Das Gefühl der Vorahnung verflog.
»Bringen wir es hinter uns.« murmelte er, hob seine rechte Hand und drückte sie auf die Glasscheibe des Bildschirms. Unter seiner Handfläche wechselte die Farbe des abgebildeten Handabdrucks von rot nach grün. Man hörte ein Klicken und Schnarren, dann öffnete sich mit einem Zischen die Schleusentür nach innen und gab den Blick auf das durch die Notbeleuchtung schwach beleuchtete Foyer frei.
Arnsberg und der Wachmann sahen sich an.
Der Wachmann bot mit einer einladenden Geste Arnsberg den Vortritt an.
»Nach ihnen, Sir.«
Arnsberg betrat das Foyer, der Wachmann folgte ihm.
»Was dann mit Arnsberg und dem Wachmann geschah ist nicht ganz klar. Mit Sicherheit wissen wir, dass beide Männer das Rechenzentrum betraten und sich für etwa 40 Minuten nicht meldeten. In dieser Zeit haben sie teilweise die Kommunikation wieder hergestellt. Zumindest meldete dies der Wachmann den Beamten der State Police. Seinen Ausführungen zu Folge waren ausgerechnet die Rechner, die für die Kommunikation zuständig waren, ausgefallen. Arnsberg hätte Notsysteme aktivieren können und zumindest eine der Telefonleitungen nach draußen funktionierte wieder. Der Wachmannschaft ging es gut. Sie hatte nach dem Notfall-Plan reagiert und die Anlage abgeriegelt, nachdem es zum Zusammenbruch der Kommunikation gekommen war.«
»Aber ich vermute, wir säßen jetzt nicht hier, wenn dies schon die ganze Geschichte gewesen wäre, richtig?« fragte Andy.
Katherine nickte. »Irgendetwas stimmte nicht. Ich wusste, ich konnte mich auf Arnsberg verlassen, aber den Ausfall einen ganzen Rechenzentrums hatte es in der Geschichte von sweepr.net noch nicht gegeben. Also beschloss ich mir vor Ort selbst ein Bild der Lage zu machen.«
level fünf
Als Katherine Williams in North Carolina eintraf, war es bereits zu Dunkel für einen Hubschrauberflug zum Rechenzentrum. Eine Limousine stand für sie bereit. Der Fahrer war ein aufgeregter Einheimischer namens Clive, der es kaum glauben konnte Katherine ›Die Göttin‹ Williams, die - laut Time Magazine - ›schönste Frau der IT-Welt‹ war, zu kutschieren. »Meine Frau wird mir nicht glauben, wenn ich ihr das erzähle.« Er lobte Katherine dafür mit dem Rechenzentrum ›wieder ein bisschen Leben‹ nach Maiden gebracht zu haben. Aber musste das ganze so geheim sein? Als Apple noch das Rechenzentrum betrieben hatte, war die Geheimniskrämerei schon immens gewesen. Elektrozäune, Wachposten und Überwachungskameras. Aber nach der Übernahme durch sweepr.net könnte man glauben, das in dem Kasten nicht Daten, sondern biologische Kampfstoffe aufbewahrt würden. Pete, einer von Clives besten Freunden arbeitete als Wachmann auf dem Gelände von sweepr.net. Über seine Arbeit im Rechenzentrum verlor er jedoch kein Wort.
»Jeder unserer Mitarbeiter ist vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet.« erklärte Katherine müde. Clive schien ein netter Kerl zu sein, aber von seinem Geplapper bekam sie langsam Kopfschmerzen.
»Falls ihr Freund etwas über seine Arbeit verlauten ließe, wäre das ein Grund für eine fristlose Kündigung und eine Klage wegen Vertragsbruch.«
»Schon gut, schon gut, Lady.« murmelte Clive.
Im Grunde bestätigte Katherine Williams nur wieder Clives Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen. Sobald Frauen einen Hosenanzug und eine Aktentasche trugen verwandelten sie sich in kalte, frigide Eisberge. Selbst die Göttin der IT-Welt bildete da wohl keine Ausnahme. Unter diesen Umständen hielt Clive es für besser nicht zu erzählen, dass sein Kumpel Pete, nach ein paar Bier im Scottie's Bar-B-Q, wirklich etwas über seine Arbeit im Rechenzentrum ausgeplaudert hatte.
»Man hört Stimmen.« hatte Pete in einem nüchternen Ton erklärt, der seinem Alkoholpegel nicht entsprach.
»Verarsch mich nicht.« sagte Clive.
»Bei Gott, ich verarsch dich nicht, Clive. Die Server …« Clive machte ein fragendes Gesicht. Er war ein absoluter Computerlaie. »Also diese Computerdinger, wo sie die Daten ihrer Kunden aufbewahren, machen zwar einen Höllenlärm, aber in den Gängen zu der Halle mit den Servern hört man nachts ab und zu Stimmen. Stimmen die Flüstern. Wütende Stimmen.«
Clive sah Pete lange an, dann lachte er laut los. »Guter Witz, Pete! Bin fast drauf reingefallen!« Er klopfte sich auf die Schenkel. Pete stimmte nicht in das Lachen mit ein. Er blieb ernst und wirkte traurig darüber, dass einer seiner besten Freunde ihn nicht ernst nahm.
»Hey, Pete.« sagte Clive immer noch glucksend. »Nichts für ungut.« Petes Miene verfinsterte sich.
»Vergiss es, Clive. Ich hab eh schon zuviel gesagt.« erklärte er knapp, trank sein Bier mit einem Zug leer und warf ein paar Scheine auf die Theke. »Ich muss jetzt los. Bestell Luisa einen Gruß von mir.«
Nach diesem Vorfall hatte Pete nichts mehr von seiner Arbeit erzählt und Clive hatte es auf sich beruhen lassen.
Und so wie nun die Eiskönigin auf seinem Rücksitz auf ein bisschen Plauderei reagiert hatte, war es wohl auch besser so.
Das Gelände des Rechenzentrums wirkte verlassen. Die Luft war angenehm kühl. Grillen zirpten in der Dunkelheit. In den Lichtkegeln der Scheinwerfer die alle fünfzig Meter am Sicherheitszaun entlang montiert waren, tanzten Moskitos. Die State Police hatte sich schon vor Stunden zurückgezogen, nachdem Arnsberg über den Wachmann ausrichten ließ, dass sie nicht weiter benötigt wurden. Katherine ging zum Sicherheitstor. An der Scheibe des Wachhäuschens neben der Schranke klebte ein handgeschriebener Zettel:
Zugang zur Zeit nur für Mitarbeiter von sweepr.net.
In dringenden Notfällen
wählen sie bitte (828) 555-2323.
Katherine wählte die Nummer mit ihrem iPhone. Es klingelte zwei Mal, dann hörte sie die Stimme des Wachmanns an der anderen Leitung.
»Ja bitte?« fragte der Wachmann unwirsch.
»Hier spricht Katherine Williams. Ich stehe vor dem Haupttor und möchte gern hinein.« Eine kurze Pause. Dann wurde die Stimme des Wachmanns gleich freundlicher.
»Hallo, Miss Williams … Ähh … Natürlich. Haben sie eventuell ihre Code-Karte dabei?«
»Die habe ich.«
»Prima. Ich muss hier gerade Mr. Arnsberg zur Hand gehen. Wenn es ihnen nichts ausmacht, dann öffnen sie doch bitte selbst das Tor mit der Karte und kommen zur Schleuse. Ich erwarte sie dann dort.«
»In Ordnung. Bis gleich.«
Katherine legte auf und wandte sich an Clive, der vor der Limousine stand.
»Könnten sie mich in zwei Stunden hier wieder abholen?« fragte sie und reichte dem Fahrer mit der Frage zugleich eine 100 Dollarnote.
Clive grinste breit. »Sehr gern, Miss Williams. Soll ich sie bis zum Gebäude fahren?«
»Nein, danke. Ich gehe zu Fuß.«
Nachdem Katherine mit Hilfe ihrer Code-Karte das Gelände betreten hatte, erreichte sie nach einem etwa zehnminütigen Fußmarsch die Sicherheitsschleuse.
Wie schon zuvor bei Arnsberg erwartete der Bildschirm neben der Schleuse ihren Handabdruck zur Identifizierung.
Katherine legte ihre Hand auf die Abbildung. Aus Rot wurde wieder Grün und die Schleuse öffnete sich.
Ohne Zögern trat Katherine in das Foyer.
Im Foyer war es dunkel und still. Das Rechenzentrum lief also immer noch im Notbetrieb. Katherine erkannte auch gleich den Grund dafür: Arnsberg, dessen Aufgabe es gewesen war das Rechenzentrum wieder in Betrieb zu setzen lag bäuchlings hingestreckt auf dem Boden. Um seine Körpermitte hatte sich ein großer Blutfleck auf dem ansonsten penibel sauberen Boden des Foyers gebildet. Er war vor jemandem oder etwas geflohen und daraufhin hatte dieses etwas oder dieser jemand ihm dann in den Rücken geschossen.
»Oh, Ronny …« sagte Katherine leise.
Zwei Meter rechts von Arnsberg Leiche lag eine weitere.
Es war ein Wachmann. Er hatte Schusswunden in Kopf und Brust. Der Kopfschuss hatte dem Mann das halbe Gesicht weggerissen. Der Schuss in die Brust hatte das Namensschild zerfetzt. Alles was Katherine erkennen konnte war ein Teil des Vor und des Nachnamens: Pete- —-pton.
Plötzlich hörte Katherine hinter sich ein Geräusch. Sie wollte sich umdrehen doch dann bohrte sich etwas kaltes und hartes in ihren Hinterkopf.
Es war der Lauf einer Pistole. Katherine schluckte und verlagerte das Gewicht von einem Bein auf das Andere. Nach ihrer Begegnung mit einem verrückten Serienkiller hatte sie mehrere Selbstverteidigungs-Kurse absolviert.
»Denk nicht mal dran, Süße.« sagte eine Stimme hinter der Pistole.
Katherine schloss die Augen und wartete auf den tödlichen Schuss.
Doch der kam nicht.
Stattdessen bohrte sich ein weiterer kalter Gegenstand in ihren Hals.
Sie hörte ein Zischen, spürte einen kurzen Schmerz und dann …
Weiß.
Gleissendes Weiß.
Alles um sie herum - der Boden, der Himmel - war … weiß.
Katherine hob schützend eine Hand vor die Augen.
Da ihr jeglicher Orientierungspunkt fehlte, konnte Katherine nicht sagen ob sie sich in einer Kammer, einer Kathedrale oder auf einer hektargroßen, weiß getünchten Ebene unter einem weißem Himmel befand.
In der Ferne kam langsam eine Gestalt auf sie zu. Ihre Bewegungen waren geschmeidig und feminin.
Eine Frau, also. Sie trug einen strahlend weißen Hosenanzug mit Kapuze. Die Hosen und das Dekolleté waren tief geschlitzt. Darunter war die Frau nackt. Mühelos und grazil stolzierte sie auf weißen Manolos. Die High Heels klickten aufreizend auf dem Boden. Die Haut und das blonde Haar der Frau schien durch den fehlenden Kontrast der Umgebung zu glühen.
Katherine kannte die Frau. In ihrer Zeit als Model hatte sie sie während der Fashion Week in New York kennengelernt.
Es war Kylie Minogue.
»Wo bin ich hier?« fragte Katherine.
Kylie Minogue, die wesentlich kleiner als Katherine war, lächelte geheimnisvoll zu ihr hinauf.
»Sie sind nicht Kylie Minogue. Wer sind sie? Und …« Sie deutete um sich herum, »Wo sind wir hier?«
»Ich bleibe auf Abstand.« sagte die Frau, die nicht Kylie war. »Ich betrachte nur aus der Ferne.«
Die Stimme war nicht die von Kylie Minogue. Es war eine künstliche, computerhafte Stimme. Das ganze hier war eine Illusion, ein virtuelles Konstrukt. Wut stieg in Katherine auf. Sie mochte nicht, wenn man Spielchen mit ihr spielte.
»Sie haben zwei meiner Mitarbeiter umgebracht! Und was zum Teufel haben sie mit meinem Rechenzentrum angestellt?«
Die Frau antwortete nicht, sondern ergriff mitfühlend Katherines Hände.
»Wir alle kennen der Liebe Schmerz. Und wir alle haben unser Kreuz zu tragen. Aber nun, im Namen von Verständnis, sollten wir unsere Last teilen. Vertraue mir. Vertraue mir.«
»Wer sind sie?« fragte Katherine.
»Ich kann ein Geheimnis bei mir halten, den Schlüssel weit von mir werfen.«
Katherine löste sich aus dem Griff der Frau und trat einen Schritt zurück. »Ich will hier raus.« sagte sie. Sie sah sich nach einem Ausgang um. Doch es gab keinen.
»Bleib, oder nicht. Die Entscheidung liegt bei dir. Aufs Geratewohl. Was mein ist, ist auch Dein.«
»Ich frage sie zum letzen Mal, wer sind sie und was geht hier vor?«
Die unechte Kylie schloss die Augen. Dann öffnete sie sie wieder und stieß ein zufriedenes Seufzen aus.
»Ahh … Wut. Das fühlt sich wirklich gut an, Katherine.«
Sie lächelte. »Um zunächst eine deiner Fragen zu beantworten … Ich bin die, die ich bin. Aber du …« Sie tippte mit ihrem kleinen kurzen Finger gegen Katherines Brustbein, »Du darfst mich ›Mutter‹ nennen.«
Katherine hörte auf zu sprechen und sah in die kleiner werdenden Flammen des Kaminfeuers.
»Warum?« fragte Andy. »Warum nennt sie sich Mutter?« Katherine schüttelte den Kopf, starrte aber weiterhin in die Flammen.
»Ich weiß es nicht.«
»Was ist dann passiert?«
»Sie ließ mich gehen, unter der Bedingung, dass ich das Rechenzentrum in Ruhe ließe. Ich sollte über die Vorfälle ebenso Schweigen wie über meine toten Mitarbeiter. Falls ich diesen Bedingungen nicht Folge leiste, werden meine Kinder und mein Mann eliminiert.« Katherine seufzte. »Das waren ihre Worte: eliminiert.«
»Hat sie gesagt, wie … nun … wie sie entstanden ist?«
»Nein. Ich kann nur vermuten, dass der Bastard Kurzweil mit seiner Theorie recht hat und wir den Punkt der Singularität erreicht haben.«
Andy pfiff überrascht durch die Zähne.
Katherine Williams bezog sich natürlich auf die Theorien des exzentrischen Erfinders und Technologiegurus Ray Kurzweil. Kurzweil vertrat die These, dass das Moorsche Gesetz, welches besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise in Prozessoren von Computern alle 18 Monate verdoppelt, auch auf andere technologische Entwicklungen übertragbar ist. Diese rasante Verbesserung wird schließlich zu einem Punkt in der technologischen Entwicklung führen, der so schnell und allumfassend sein wird, dass er einen ähnlichen Bruch in der Struktur der Geschichte der Menschheit darstellt, wie die Entdeckung des Feuers. Für Kurzweil ist dieser Bruch dann erreicht, wenn eine Maschine eine Schwelle zur künstlichen Intelligenz erreicht hat, in der sie sich aus sich selbst heraus verbessert und damit immer intelligenter wird, bis sie schließlich die Intelligenz eines Menschen erreicht oder sogar übersteigt.
Diesen unumkehrbaren Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte bezeichnete Kurzweil als die ›Singularität‹.
Bis eben war der Begriff der Singularität für Andy nichts weiter als eine von vielen Theorien über die Zukunft der technologischen Entwicklung gewesen. Er wollte Kurzweil und seinen Theorien in seinem Buchprojekt über Hacker ein Kapitel widmen.
Und nun? Nun war die Suche nach künstlichem Leben in den Untiefen von Codezeilen und Rechenzentren offenbar Wirklichkeit geworden.
»Wir sprechen hier über eine Seed KI, nicht wahr?«
Katherine nickte langsam. »Zu diesem Schluss sind meine Experten auch gekommen. Als unsere Ingenieure die gespeicherten Informationen in unseren Rechenzentren als Grundlage verwandten, um die simulierte Welt des Streams zu erzeugen, entwickelten sie eine Schnittstelle um die emotionale Interaktion mit Menschen im Stream zu verbessern. Die bei uns gespeicherten Informationen waren der Same, die Aminosäuren, wenn sie so wollen, die das künstliche Leben brauchte um sich zu entwickeln.
Um die Informationen des Streams für einen Menschen sinnvoll erfahrbar zu machen, mussten sie diesen Interpreter, diese Schnittstelle zwischen Mensch und Daten mit einer rudimentären künstlichen Intelligenz versehen. Darüber hinaus musste diese KI die Fähigkeit besitzen aus ihren Fehlern in der emotionalen Interaktion zu lernen und ihr Verhalten zu optimieren. Dies hat nun dazu geführt, dass diese KI so etwas wie ein Bewusstsein entwickelt hat.«
»Skynet wird sich seiner selbst bewusst.« murmelte Andy.
»Ich habe den Film ›Terminator‹, den sie da zitieren gesehen. In den letzten Wochen habe ich glaube ich fast alles über das Thema Künstliche Intelligenz gelesen, gesichtet und studiert. Und ich bin zu einer Entscheidung gelangt.«
»Die wäre?«
Katherine sah Andy lange an.
»Können sie sich das nicht denken? Ich werde der Schlampe den Stecker ziehen.«
Andy räusperte sich.
»Wie wollen sie das anstellen?«
»Lisa.«
»Das Mädchen?!«
»Dieses ›Mädchen‹ gehört zu den besten Hackern der Welt. Lisa hat einen Weg gefunden das gesamte Rechenzentrum und damit ›Mutter‹ abzuschalten.«
»Und wozu brauchen sie dann mich?«
Katherine lächelte.
»Sie sind ein vielbeachteter Technologie-Journalist mit einem sehr guten Ruf, Andy. Sie sollen Lisa begleiten und nachdem alles vorbei ist, darüber berichten. Exklusiv.«
»Puh.« sagte Andy und rieb sich die Augen. »Ich glaube, da brauche ich ein wenig Bedenkzeit.«
Katherine schaute auf ihre Armbanduhr.
»Sie haben etwa dreißig Minuten. Dann macht sich Lisa auf den Weg nach North Carolina. Mit oder ohne sie.«
Elf Stunden später fuhr Andy, zusammen mit Lisa Arnold, von der Interstate 40 ab, auf die Route 321 Richtung Süden.
Sie hatten die aufreibende Fahrt nach Maiden in Andys altem 95er Crown Victoria unternommen.
Andys Crown Vic war nicht unbequem, doch Andy stellte vor Fahrtantritt die Frage, warum sie beispielsweise nicht Katherine Williams Porsche Cayenne verwenden durften.
»Ihre alte Klapperkiste ist ideal. Kein GPS. Keine aufwendige Elektronik. Nichts, was ›Mutter‹ einfach orten oder ausser Gefecht setzen kann. Aus dem selben Grund reisen wir nicht mit Flugzeug oder Helikopter.« erklärte Lisa. Sie trug dunkle Kleidung, eine dunkle Schirmmütze und ihren Rucksack. Sie warf den Rucksack auf den Rücksitz und nahm auf dem Beifahrersitz seiner ›Klapperkiste‹ platz. »Sie fahren die erste Schicht.« fügte sie noch hinzu, zog die Schirmmütze herunter und schloss die Augen.
Andy seufzte, setzte sich hinter das Steuer und fügte sich in sein Schicksal.
Nach ungefähr zehn Meilen passierten sie auf der rechten Seite das Rechenzentrum von sweepr.net.
»Weiterfahren. Nicht die Geschwindigkeit reduzieren.« befahl Lisa. Andy tat, wie ihm geheißen.
Sie fuhren weiter die Route 321 entlang bis sie die Stadt Lincolnton erreichten. Lisa wies Andy den Weg zum ›Hampton Inn‹ Hotel.
Andy brachte den Wagen in einer der Parkbuchten vor dem Hotel zum stehen und machte den Motor aus.
»Und nun?« fragte er.
»Hier bleiben wir.« sagte Lisa und stieg aus. Andy tat es ihr gleich, doch mit wesentlich weniger Grazie. Er fühlte sich wie gerädert. Als er sich reckte, knackten seine Knochen. Er sah auf seine Mickymaus-Uhr. Es war weit nach Mitternacht.
»Wieso bleiben wir hier und suchen uns nicht was näher am Datacenter?« fragte Andy. Sie waren auf dem Weg an mindestens zwei weiteren Motels vorbeigekommen.
»Schnelles Internet, alter Mann.« erklärte Lisa knapp.
»Die Jugend ist etwas Wundervolles. Es ist eine Schande, dass man sie an die Kinder vergeudet.« murmelte Andy.
»Was?« fragte Lisa.
»Nichts.« erwiderte Andy und folgte, in seinem Alter angemessenen Schritt, dem Mädchen ins Hotel.
Als Andy die Rezeption im Foyer des Hotels erreichte, hatte Lisa den Concierge bereits in ein Gespräch verwickelt.
Sie hatte die Arme auf den Tresen abgestützt und gewährte damit einen offenherzigen Blick in ihren Ausschnitt.
»Also ich selbst hätte nicht geglaubt, dass ein Mann über vierzig so gut im Bett sein kann. Aber ich kann ihnen echt sagen, man nennt Professor Jenkins auf dem Campus nicht umsonst ›den Hengst‹!« Lisa sah Andy kommen und grinste ihn an.
»Da kommt er schon.« Sie kaute lautstark auf ihrem Kaugummi herum. »Mal ehrlich, sieht für sie so eine Sexmaschine aus?«
Der Concierge, ein älterer, schmaler Mann musterte Andy misstrauisch … und ein wenig angewidert.
»Guten Abend, Sir.« begrüßte er Andy. Lisa grinste immer noch. Andy gelang es irgendwie die Fassung zu wahren.
»Bitte glauben sie der Kleinen kein Wort. Sie ist eine notorische Lügnerin.« erklärte er ruhig und deutete mit dem Daumen auf Lisa. »Ich bin ihr Bewährungshelfer. Mein Name ist Curkow. Für mich müsste ein Zimmer reserviert sein.« Er machte eine Pause. »Mit zwei getrennten Betten. Ich hätte zu gern ein Einzelzimmer, aber man kann die Kleine leider nicht aus den Augen lassen, bis ich sie wieder in der Besserungsanstalt abliefere.«
Lisas Grinsen erlosch.
»Natürlich Sir.« sagte der Mann freundlich. Nachdem Andy die Anmeldung ausgefüllt hatte bezahlte er das Zimmer in Bar.
»Komm Kleines.« sagte er zu Lisa und führte sie am Arm zu den Fahrstühlen.
Das Zimmer lag in der vierten Etage, war erstaunlich geräumig und verfügte über die reservierten zwei getrennten Betten. Lisa ging mit verschränkten Armen zum Fenster, dann drehte sie sich um und sah Andy wütend an.
»Was sollte das eben? Warum lassen sie unsere Tarnung auffliegen?« fauchte sie.
Andy stellte seine Tasche ab und hängte seinen Hut an einen Haken neben der Tür.
»Im Gegensatz zu ihnen, lege ich Wert auf meine Selbstachtung, Miss Arnold.«
»Selbstachtung?« rief sie. »Sie sind ein fetter, alter Journalist, der über Unterhaltungselektronik in obsoleten Medien wie Zeitungen berichtet!«
Andy seufzte. »Für sie mag ich nur ein alter, fetter Journalist sein der in obsoleten Medien über langweilige Unterhaltungselektronik berichtet. Aber dafür kann ich ohne Abscheu jeden Morgen in den Spiegel blicken. Aus einem mir nicht erfindlichen Grund, scheint das bei ihnen nicht der Fall zu sein, Miss Arnold.«
Lisa biss sich auf die Lippen. In ihren Augen standen Tränen. Sie drehte sich um und starrte aus dem Fenster.
Ups. Da haben wir wohl einen Nerv getroffen, dachte Andy. Es war nicht seine Absicht gewesen, die junge Frau so zu verletzen. Allerdings musste er zugeben, dass ihre Art seinen Gleichmut auf eine harte Probe stellte.
Seien wir doch mal ehrlich. Sie hat mich betäubt, entführt und mich seit wir uns kennen, wie den letzten Dreck behandelt. Kann man mir da verübeln Lisa ein wenig in ihre Schranken zu weisen?
Eigentlich nicht.
Aber wer ist hier der Erwachsene Andy?
Andy seufzte.
»Es tut mir leid. Das war nicht fair.« sagte er.
Lisa fuhr sich mit der Hand über die Augen. Andy konnte nur vermuten, dass sie sich Tränen aus den Augen wischte, denn sie stand immer noch mit dem Rücken zu ihm.
»Nein.« sagte sie und drehte sich wieder zu ihm, »Mir tut es leid. Sie haben recht. Ich habe ein Problem, wenn ich in den Spiegel sehe.« Sie lächelte traurig. »Meine Mutter ist Ashera Arnold, müssen sie wissen.«
»Oh.« war alles, was Andy darauf entgegnen konnte.
»Aber … das bedeutet …« begann er. »Das bedeutet, dass meine Mutter für das Leid, was der Serienkiller Parker Daley seinen Opfern und Katherine Williams angetan hat, die Verantwortung trägt.« führte Lisa Andys Gedankengang fort.
»Aber sie sind nicht ihre Mutter, Lisa.«
»Nein. Das bin ich nicht.« sagte sie. Sie seufzte. »Ich bin schlimmer. Wegen ihrer Verbrechen wurde meine Mutter zu mehrfacher lebenslanger Haft verurteilt. Ich weiß also, wozu sie fähig ist. Ich weiß, was sie all den Menschen angetan hat. Aber meine Mutter operierte aus dem Gefängnis einfach weiter. Sie verlangte von mir, dass ich ihre ›Geschäfte‹ fortführte. Sie übertrug mir die Leitung eines weiteren Geheimprojekts des Pentagon mit dem Namen ›Charon‹. Es sollte dazu dienen Informationen von Kombattanten direkt aus ihrem Gehirn zu extrahieren. Dazu wurde versucht die in den Gehirnen von Soldaten mit schweren Hirntraumata und von Wachkomapatienten gespeicherten Informationen in einen Computerspeicher zu übertragen und auszuwerten.«
Das Leben steckt voller Überraschungen, dachte Andy. Ich dachte wirklich, das was mir Katherine Williams erzählt hat, ist das verrückteste was ich je gehört habe.
»Und?« fragte Andy.
Lisa lachte bitter. »Das Projekt war natürlich ein Desaster. Alle Patienten starben.« Sie machte eine Pause. »Bis auf Eine.« Lisa holte das altmodische Nokia Mobiltelefon hervor. Sie schaltete es ein. Auf dem Display erschien das Andy bereits bekannte stilisierte Gesicht. »Darf ich vorstellen: Das ist Phil. Ehemals Phyllis Ryan.«
»Just Another Story.« verkündete das Telefon gelassen.
Andy starrte auf das Telefon. Dann zu Lisa Arnold. Wieder zum Telefon. Wieder zu Lisa. Er hob fragend einen Finger in die Luft, öffnete den Mund um etwas zu sagen, schloss ihn wieder. Dann drehte er sich um, ging in das Badezimmer und schloss die Tür hinter sich.
Im Badezimmer wusch Andy sich das Gesicht und starrte dann in den Spiegel über dem Waschbecken.
Er sah blass und ausgemergelt aus.
Kein Wunder. Du hast in den letzten zwei Tagen mehr durchgemacht als in deinem bisherigem Leben!
Aber das war nur die halbe Wahrheit. Denn innerlich fühlte er sich so lebendig wie schon seit Jahren nicht mehr.
Klar. Das ist das Adrenalin. Aber wenn das erstmal weg ist, fällst du in den Abgrund. Leg schon mal ein bisschen Geld beiseite für einen guten Therapeuten.
»Bullshit.« sagte Andy laut. Egal wie verrückt das alles war. Er musste sich eingestehen, dass es aufregend war, ein wenig gefährlicher zu leben als üblich.
Was Andy nicht ahnte, war wie gefährlich sein neues, aufregendes Leben in den nächsten Stunden noch werden würde.
Lisa stand vor der Badezimmertür und horchte hinein. Phil hielt sie in der Hand.
»Do You Know, Do You Care?« fragte Phil.
»Er kriegt sich schon wieder ein.« sagte Lisa. »Er muss alles erst einmal verdauen. Er ist alt.«
Die Badezimmertür öffnete sich.
»Das habe ich gehört.« sagte Andy. Er wirkte müde, aber gefasster.
»Can't Turn Back The Years.«, bemerkte Phil.
»Klappe, Null-Bit.« grummelte Andy und setzte sich auf eines der Betten. Er rieb sich mit beiden Händen das Gesicht.
»In Ordnung. Okay. Es gibt also bereits zwei echte künstliche Intelligenzen auf diesem Planeten.«
»Phil ist keine künstliche Intelligenz. Phil ist das digitale Abbild eines ehemals lebendigen Menschen.«
»Warum redet sie dann so komisch?«
»That's Just The Way It Is.«, erklärte Phil selbst. Andy sah fragend auf zu Lisa. »Sie hat recht. So redete Phil schon, als ich sie kennenlernte. Allerdings war sie da noch über zwei Meter groß und hätte ihnen für diese Bemerkung den Arm aus dem Gelenk gedreht.« Sie machte eine Pause. »Hören sie. Ich werde ihnen irgendwann einmal die ganze Geschichte erzählen. Aber jetzt müssen wir erst einmal die durchgedrehte KI über den Jordan schicken. Okay?«
Andy nickte. »Okay.«
Sie fuhren mit Andys Wagen bis zur Abfahrt zum Rechenzentrum. Er parkte den Wagen am Straßenrand und schaltete die Warnblinkanlage ein. Dann stiegen sie aus. Andy klemmte einen von Lisa vorbereiteten Zettel hinter den Scheibenwischer:
Panne. Hole Hilfe.
Den verbleibenden Weg zum Eingangstor des Rechenzentrums legten sie zu Fuß zurück.
Vor dem Tor blieben sie stehen. Andy sah Lisa fragend an.
Sie sagte nichts. Ihre Hand berührte den Gurt ihrer Umhängetasche. In einer kleinen Tasche vor ihrer Brust steckte Phil. Das Display des Telefons leuchtete kurz auf, dann wurde es wieder dunkel.
Eine Minute verstrich. Zwei.
»Phil?«, erkundigte sich Lisa.
»You Can’t Hurry Love.« antwortete Phil. Das Display wurde wieder dunkel. Nach einer weiteren Minute leuchtete es wieder auf.
»Behind The Lines.« sagte Phil. In Andys Ohren klang es triumphierend. Elektromotoren surrten und das stählerne Tor glitt beiseite.
Das Wachhäuschen neben dem Tor war leer und dunkel. Daneben stand ein elektrischer Golfkarren. Lisa prüfte die Anzeige der Batterien.
»Halb voll.« sagte sie. »Müsste reichen.« Sie stieg auf den Fahrersitz. »Kommen sie. Das war erst Level Eins.«
Andy setzte sich auf den Beifahrersitz. Lisa trat das Pedal für die Beschleunigung durch. Der Golfkarren schoss so ruckartig vorwärts, das Andy fast hintenüber aus dem Fahrzeug gefallen wäre.
»Festhalten!« rief Lisa, als sie auf das Rechenzentrum zurasten.
»Langsam wird mir klar, warum ich die ganze Strecke von Maryland fahren musste.« brummte Andy.
»Haben Sie was gesagt?« fragte Lisa.
»Nope.« erwiderte Andy und umklammerte den Haltegriff seines Sitzes.
Fünf Minuten später standen sie vor der geschlossenen Sicherheitsschleuse. Sechs Wochen und drei Tage nachdem Katherine Williams diese passiert hatte - und nach einem kurzem Palaver mit ›Mutter‹ wieder hinausgeworfen worden war.
»Jetzt also zu Level Zwei.« seufzte Lisa.
Sie nahm Phil aus der Tasche und hielt das Telefon gegen den dunklen Bildschirm neben der Schleuse.
Wieder leuchtete das Telefon auf. Doch diesmal sagte Phil nichts, sondern gab eine Reihe abgehackter Quietschlaute von sich, die Andy an die Geräusche eines altmodischen Telefonmodems erinnerten.
Aus dem inneren des Rechenzentrum hörte man ein tiefes Klacken und auch die Schleuse öffnete sich wie von Geisterhand.
»Woher kann Phil das?« fragte Andy.
»Phil interagiert mit dem Code nicht wie eine Maschine, sondern wie ein Mensch. Sie improvisiert. Sie folgt ihrer Eingebung, ihrem Bauchgefühl.« erklärte Lisa, nicht ohne Stolz. »Da kommt keine K.I. gegen an.«
Die Schleuse war nun vollständig geöffnet. Drinnen war es dunkel. Lisa holte aus ihrer Umhängetasche eine kleine Stablampe hervor, schaltete sie ein und leuchtete in das Innere des Foyers.
»Alrighty.« sagte sie. Andy zögerte. Er sah an sich herunter. »Ich will gehen, aber meine Beine wollen nicht.«. Lisa kam zu ihm und legte ihm die Hände auf die Schultern.
»Hey, keine Angst, alter Mann. Vorhin im Hotel habe ich eine gewaltige DoS-Attacke von der Leine gelassen und sweepr.net damit vollständig lahmgelegt. Wir sind jetzt nur noch hier, um den Stecker zu ziehen. Dann ist es mit ›Mutter‹ aus und vorbei. Sie schreiben ihr Buch über die ganze Sache, kriegen den Pulitzer-Preis und können Steven Levy eine Nase drehen. Wie klingt das, Andy?«
»Wundervoll.« sagte Andy leise. Lisa tätschelte ihm die Wange. »Na, also. Dann los.«
Im Lichtschein von Lisas Taschenlampe durchschritten sie das Foyer.
Andy nahm einen leichten Zimtgeruch in der Luft wahr. »Riechen sie das auch?« fragte er Lisa.
»Ja.« Der Geruch wurde stärker. Dann stießen sie auf die Leiche von Arnsberg. Andy konnte ein würgen nicht unterdrücken.
»Alles klar, alter Mann?« Andy holte ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und hielt es sich vors Gesicht. Er nickte. »Yep.« Die Leiche von Arnsberg wirkte wie die eines alten Mannes. Die Mumifizierung hatte nach Wochen in der trockenen und sauberen Luft des Rechenzentrums bereits eingesetzt.
»Scheiße.« murmelte Andy. »Stimmt.« pflichte Lisa ihm bei. Sie gingen weiter und passierten die Leiche des Wachmanns. Andy blieb plötzlich stehen.
»Was ist mit dem falschen Wachmann, demjenigen der Katherine Williams überfallen hat? Was ist, wenn der noch da ist?«
»Ist er nicht.« sagte Lisa. »Wurde alles per Satellit gecheckt. Der Typ hat zwei Tage nach dem Besuch von Katherine einen größeren Typen hineingelassen. Eine Woche später sind beide dann mit einem der Lieferwagen abgehauen. Seit fünf Wochen ist hier niemand rein oder rausgekommen. Es gibt hier nur sie, mich und ›Mutter‹.«
»Halt hinter ihrem Wagen.« sagte Lacey zu dem rothaarigen Riesen. Ronald brachte den Lieferwagen hinter dem Wagen von Andy Curkow zum stehen.
»Was für eine Scheißkarre.« sagte Lacey, als er Andys Crown Vic im Licht der Scheinwerker betrachtete.
»Was sollen wir tun?« fragte Ronald.
»Warten.« sagte Lacey und lehnte sich zurück. Ronald verzog fast unmerklich die Lippen. Lacey grinste.
»Es juckt dich, was? Du willst wissen, was sie mit deinen Prototypen angestellt hat, stimmts?«
Ronald nickte langsam.
»Keine Bange. ›Mutter‹ macht aus der kleinen Schlampe Kleinholz. Wir kehren gleich nur noch die Späne zusammen.«
Endlich standen Lisa und Andy vor der Tür zur großen Halle mit den Servern.
»Level Drei.« sagte Lisa und aktivierte Phil. Nach nur einer Minute verkündete das Mobiltelefon erneut: »Behind The Lines.« Sie hörten wie die Tür entriegelt wurde.
»Das war einfach.«, kommentierte Lisa. Die Tür hatte einen einfachen Drehknauf. Lisa legte die Hand darauf. Andy hielt sie zurück.
»Warten sie.« sagte Andy.
»Was ist?« fragte Lisa.
»Ich weiß nicht.« sagte Andy. »Es ist nur … Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache.« Lisa lächelte. »Das ist bestimmt das elektromagnetische Feld von den paar tausend Servern hinter dieser Tür. Der Elektrosmog bringt nur ihre Synapsen durcheinander.«
Andy wollte noch etwas sagen, doch Lisa hatte bereits die Tür geöffnet. Unbeschreiblicher Lärm tausender Lüfter von tausenden von Servern machte jedes Gespräch unmöglich. Je 50 Server waren in kühlschrankgroßen Gehäusen. Die Gehäuse standen zu hunderten in Reih und Glied. In mehr als zwei dutzend Reihen nebeneinander und über mehrere Stockwerke übereinander. Andy hatte in seinem Leben schon einige Rechenzentren besucht, aber die Dimensionen von diesem hier hatte er noch nie gesehen. Lisa wirkte von all dem unbeeindruckt. Sie holte eine Packung Hearos Ohrstöpsel hervor, öffnete sie und reichte Andy ein Paar. Andy stopfte sich die Stöpsel in die Ohren. Sofort war der Lärm auf ein erträgliches Maß reduziert. Lisa bedeutete Andy mit Handzeichen, dass sie zum Ende der Halle gehen wollte. Dort befand sich ein kleiner Kontrollraum von dem die Server mit Energie versorgt wurden. Das ganze Rechenzentrum wurde mittels einer Solaranlage versorgt. Lisas Plan sah vor, die Zugangsleitungen vom Solarkraftwerk zu kappen und den Servern - und damit ›Mutter‹ - die Energie abzudrehen.
Andy teilte mit einem erhobenen Daumen Lisa mit, dass er verstanden hatte. Lisa setzte sich in Bewegung, Andy folgte ihr dicht auf.
Der Weg durch die Halle schien endlos. Lisa hatte einen Weg etwas links von der Eingangstür gewählt. Zielstrebig ging sie voraus, Andy folgte.
Sie hatten etwa die Hälfte des Gangs durchschritten, als Andy wieder dieses ungute Gefühl einer bösen Vorahnung erfasste.
Stell dich nicht so dumm an, Andy. Die Kleine ist halb so alt, wie du und hat zehn mal mehr Mumm. Andy versuchte auf seine innere Stimme zu hören.
Alles halb so wild. Wahrscheinlich hatte Lisa recht. Der ganze Elektrosmog wirbelt nur meine Synapsen durcheinander. Er betrachtete das nächstbeste Rack mit Servern neben sich. In jedem Rack waren mindestens fünfzig schmale Serverblades verbaut.
Um sich von seiner Angst abzulenken, versuchte Andy die Anzeigen auf einem der Server abzulesen, was im halbdunkel der Halle recht schwierig war.
Seltsam, dachte er. Müsste es hier nicht viel heller sein? Immerhin blinkten und blitzten allein in diesem Gang tausende von Leuchtdioden, die in den Servern verbaut waren, um den regen Datenverkehr anzuzeigen.
Da fiel Andy auf, dass in den Regalen keine der Leuchtdioden aufblitzte.
Er blieb stehen. Lisa sah sich nach ihm um und blieb ebenfalls stehen.
»Was ist?« formten ihre Lippen fragend. Andy beachtete sie nicht, sondern legte eine Hand auf einen der Server. Er erstarrte und sah Lisa an. Diese rollte mit den Augen und kam zu ihm zurück.
»Was ist los?« fragte sie wieder, zumindest las Andy auch diese Frage von ihren Lippen ab. Andys Gesicht war kalkweiss. Er deutete auf das Rack neben sich. Lisa schüttelte verständnislos den Kopf. Andy ergriff mit seiner Hand die ihre und presste ihre Handfläche auf eines der Serverblades. Lisa wollte die Hand gerade zurückziehen, als sie verstand, was Andy meinte.
Das Blade war abgeschaltet. Keine seiner zahlreichen Leuchtdioden leuchtete, keiner der Lüfter blies.
Lisa überprüfte das gesamte Rack. Keiner der darin verbauten Server lief. So verhielt es sich auch mit den Rack daneben und den Racks gegenüber.
Ihr bisher so selbstsicher wirkendes Gesicht nahm einen kindlichen, verwirrten Ausdruck an.
Dann huschte ein kleiner, schneller Schatten von der Decke und traf Lisa am Kopf.
Lisa schrie vor Schreck und Schmerz. Sie griff sich ins Haar. Ihre Fingerspitzen waren voller Blut.
Lisa betrachtete ihr eigenes Blut mit ungläubigem Staunen. Dann sah sie langsam zur Decke hinauf. Andy folgte ihrem Blick.
Die Decke bestand aus kleinen, dunklen Panelen. Sie waren unterteilt in vier runde Abschnitte in denen sich Lüfterrotoren drehten. Ihr Lärm war es, den sie hörten. Die Server um sie herum waren abgeschaltet. Andy blinzelte und sah noch einmal hin. Nein. Es waren keine Panele mit Lüftungsrotoren. Es waren Quadrocopter.
Dutzende. Hunderte. Tausende von Quadrocoptern. Sie hingen kopfüber an der Decke wie ein schlafender Schwarm von Fledermäusen. Einer davon hatte sich von der Decke gestürzt und Lisa am Kopf verletzt.
Er schwebte jetzt etwa drei Meter über ihren Köpfen.
Lauernd. Wartend.
Andy packte Lisa am Ärmel. Sie zuckte zusammen und sah ihn an. Blut rann ihr langsam die Schläfe hinab. Ihr Mund formte nur ein Wort.
»Lauf.«
Sie rannten los.
Andy war nie ein besonders schneller Läufer gewesen. Sein Übergewicht war normalerweise auch keine besondere Hilfe bei seiner körperlichen Ertüchtigung. Er hatte in der Schule sich ein Semester lang im Schwimmteam abgemüht, am Ende des Semesters aber dann beschlossen, dass es bessere Verwendung für seine Lebenszeit gab. Schreiben zum Beispiel. Diese Entscheidung bereute er nun, aber Andy hatte sich auch nie vorstellen können, dass er einmal um den Erhalt genau dieses Lebens rennen musste.
Etwa drei Meter vor der Tür warf er einen schnellen Blick über die Schulter. Lisa müsste eigentlich genau hinter ihm sein.
Sie war es nicht.
Und was Andy stattdessen sah, ließ ihn fast stehenbleiben. Aber nur fast, was er sich den Rest seines Lebens lang vorwerfen würde.
Lisa war umgeben von einem Schwarm der Quadrocopter. Sie mussten über eine Arte Klinge verfügen, denn sie schnitten Lisa die Kleider vom Leib. Und wenn Andy, im letzten Moment, bevor er sich wieder umdrehte und sich gegen die geschlossene Tür warf richtig gesehen hatte, dann schnitten die Copter auch darüber hinaus, den er konnte Blut spritzen sehen.
Dünn und neblig, wie ein leichter Sommerregen.
Andy prallte gegen die Tür. Sie sprang nicht aus ihren Angeln, aber fast. Er schlitterte über den glatten Boden und wäre beinahe gestürzt.
Irgendwie fing er sich. Noch einmal überlegte er Lisa zu Hilfe zu eilen. Dann hörte er über all dem surrenden Lärm der Copter ihren gellenden Schrei.
Das löste in Andy blinde Panik aus. Wie von Sinnen rannte er zurück zum Foyer.
Er blickte nicht mehr zurück. Er wurde nicht langsamer.
Er war kein Held. Er war ein Feigling. Das wusste Andy nun. Und in diesem Moment war es ihm egal.
Er wollte nur leben.
Ronald und Lacey beobachteten, wie Andy Curkow aus dem Rechenzentrum gerannt kam und mit weltrekordverdächtiger Geschwindigkeit auf seinen Wagen zuhielt. Die beiden saßen immer noch in dem Lieferwagen und der parkte immer noch hinter dem Wagen des dicken Reporters.
Andy sah den Lieferwagen und dann sie — und wurde langsamer.
Als er seinen Wagen erreichte, war sein Lauf nur noch ein langsames Tapsen. Unsicher stand an der Fahrertür seines Wagens.
Lacey grinste Andy an und winkte im kurz zu. Dann vollführte er mit der gleichen Hand eine Geste, die dem Reporter bedeuten sollte, dass er sich nun entfernen durfte. Andy sah Lacey und Ronald kurz an, dann senkte er beschämt Blick, stieg in seinen Wagen und versuchte ihn zu starten.
Er würgte den Wagen ab. Dann versuchte er es erneut. Der Wagen startete, und Andy trat das Gaspedal durch. Er wendete schlitternd. Dabei bemerkte er, dass die Handbremse noch angezogen war. Er löste sie und seine Klapperkiste aus Detroit machte einen Satz vorwärts. Das Manöver erinnerte Lacey an ›Benny‹, das Taxi aus ›Roger Rabbitt‹. Der Wagen mit dem Reporter darin raste in Richtung Interstate.
Offenbar hatte er genug von ›Toontown‹ für eine Nacht. Lacey grinste Ronald an: »Komm. Fegen wir die Scherben zusammen.«
Lacey hatte vermutet, dass sie in der Serverhalle kein schöner Anblick erwarten würde, aber als er die blutüberströmte Schlampe in dem Fetzen ihrer eigenen Kleidung am Boden liegen sah, pfiff er anerkennend durch die Zähne.
Das Mädchen hatte die Augen verdreht. Ihre Muskeln zuckten und ihr Körper zitterte vom Schock.
Lacey hockte sich hin und durchsuchte den Haufen ihrer Kleider nach dem Mobiltelefon. Er fand es und steckte es ein. Dann packte er das Mädchen an einem Fussgelenk. Dabei achtete er pedantisch darauf, dass er nicht die Ärmel seiner weißen Spyder Jacke mit dem Blut des Mädchens beschmutzte. Dann schleifte er das Mädchen wie einen nassen Sack über den Boden zum Eingang.
Draussen übergab er das Mobiltelefon an Ronald. Dieser nickte und versuchte nicht das blutige, nackte Mädchen zu ihren Füßen zu beachten. Ronald hatte einen empfindlichen Magen. Das hatte schon seine Mutter immer gesagt. Also konzentrierte er sich lieber auf seine Aufgabe. Er verband das Mobiltelefon mittels eines Kabels mit einem Terminal in der Nähe der Eingangstür zur Halle.
Während Ronald arbeitete, hockte sich Lacey neben das Mädchen und strich ihr mit einer zärtlichen Geste das blutige Haar aus dem Gesicht.
»Mann, Baby. Hat dich ›Mutter‹ gefickt, oder hat sie dich gefickt?« fragte er sie. Das Mädchen hatte sich inzwischen wieder gefangen. Zumindest war sie nun in der Lage Lacey anzuspucken. Dieser wischte sich angewidert das Blut aus dem Gesicht. Ein paar Tropfen davon waren auf seine Spyder Jacke gespritzt.
»Scheiße, Mädchen, sie dir die Sauerei an!« mokierte er sich. Das nahm das Mädchen zum Anlass, Lacey kräftig in die Weichteile zu treten und aufzuspringen. Lacey fiel um. Durch den Schmerz streckte er aber seine Beine und schaffte damit das Mädchen wieder zu Fall zu bringen. Sie landete unsanft auf ihrem Hinterteil und biss sich auf die Zunge.
Wieder spritzte Blut aus ihrem Mund.
Wieder landete davon etwas auf Laceys Jacke.
»Gottverdammte Schlampe!« rief er, schwang sich auf sie und ignorierte dabei die brennenden Schmerzen in seinem Unterleib. Er packte sie am Hals und den Haaren und hieb ihren Hinterkopf ein paar Mal auf den Boden. Das Mädchen verdrehte die Augen und verlor das Bewusstsein. Schwer atmend stieg Lacey von dem Mädchen und begann es mit Kabelbindern zu fesseln.
Er seufzte. Fuck. Seine schöne Jacke war ruiniert.
Egal, bald konnte er sich dutzende neue Jacken kaufen. Er konnte sich einen gottverdammten Jackenharem anschaffen. Diese Aussichten stimmten ihn ein wenig milder. Er trat der Schlampe nur noch einmal mit der Stiefelspitze in den Unterleib.
Dann wandte er sich an Ronald.
»Und? Ist ›Mutter‹ glücklich?« fragte er den Riesen. Ronald nickte.
»Gut. Dann lass uns abhauen.« Ronald deutete auf das Mädchen. Lacey deutete mit einem erhobenen Zeigefinger an, dass sich Ronald einen Moment gedulden sollte. Lacey holte sein Mobiltelefon hervor und wählte eine Nummer. Eine weibliche Stimme am anderen Ende gab ihm Instruktionen. Lacey legte auf.
»Wir sollen sie und das olle Telefon nach Kalifornien mitnehmen. Und bevor wir abdampfen sollst du bitte alle Türen der Anlage öffnen.«
Ronald nickte, wandte sich an das Terminal und gab ein paar Befehle ein. Dann grunzte er zufrieden.
»Erledigt.«
Lacey deutete auf das Mädchen. »Könntest du sie bitte tragen, ich hab genug von der Schlampe.«
Ronald seufzte, packte das Mädchen und warf es sich mühelos über die Schulter.
»Danke, mein Großer. Nun, lass uns abhauen.«
Andy fuhr so schnell er konnte die Interstate Richtung Norden entlang, als er in den Rückspiegel blickte. Der fast volle Mond illuminierte ein paar vorbeiziehende Wolkenfetzen. Dann wurde es dunkel. Etwas flutete über den Himmel und verdeckte die Wolken. Es sah im ersten Moment aus wie ein gewaltiger Vogelschwarm, doch Andy wusste, dass es etwas anderes war.
Andy strich sich durchs Haar. Er jetzt bemerkte er, dass er bei seiner Flucht seinen Fedora verloren hatte.
Indy hat nie seinen Hut verloren.
Aber Indiana Jones war ja auch ein Held. Er war ein Feigling. Er hatte Lisa in den Fängen dieses Monsters zurückgelassen.
Wieder sah er in den Spiegel. Der Schwarm der Quadrocopter schraubte sich den Nachthimmel hinauf wie eine Windhose.
Was hatte ›Mutter‹ mit diesen Dingern nur vor?
Andy wusste es nicht. Es interessierte ihn auch nicht mehr. Er wusste, dass es vorbei war. Es würde ein paar Wochen, vielleicht einen Monat dauern bis es die Menschen merken würden, aber die Büchse der Pandora war nun für immer aufgestoßen.
Die Singularität war in der Welt.
Für die Menschheit würden nun interessante Zeiten anbrechen.
Andy beschloss, zurück nach Boston fahren. Sein Großvater hatte vor der Stadt eine Hütte im Wald.
Dort würde er sich verkriechen —
Und auf das Ende warten.
Teil Drei
level sechs
Dunkelheit.
Dunkelste Dunkelheit.
Dann … ein pulsierendes Licht.
Ich liege auf einem grünen, strahlenden Quadrat inmitten unendlicher Schwärze.
Blink. Mir ist schwindelig.
Blink. Ich fühle mich wie ausgekotzt.
Blink. Dieses blinkende Licht geht mir ziemlich auf den Zeiger.
Blink. Wo …
Blink. … bin ich zum Teufel? Eine Stimme sagt es mir.
Blink. Du bist bei mir.
Blink. Wer hat das gesagt? frage ich.
Blink. Für immer.
Blink. Wer hat das gesagt?! rufe ich.
Blink. Immer und Immer.
Blink. Wer hat das gesagt?! schreie ich.
Blink. Liebste.
Ich glaubte, dass ich wieder auf einem der leuchtenden Quadrate im Billie Jean Musikvideo lag, doch dieses hier war größer und leuchtete nicht in hellem Weiß, sondern in dem giftigen Grün einer Kathodenstrahlröhre.
#00FF00, in hexadezimalem Code gesprochen.
Ich versuchte aufzustehen. Sofort wurde mir schwindelig und ich unterbrach den Versuch.
Gut. Erst einmal versuchen sich zu orientieren. Dann konnte ich immer noch aufstehen.
Ich starrte an die Decke, was gar nicht so einfach war, denn in dem Raum, in dem ich mich befand schien es keine Decke zu geben. Über mir war nur Dunkelheit. Ich drehte den Kopf nach links und nach rechts. Ebenfalls nur Dunkelheit.
Wo zum Teufel bin ich hier?, dachte ich.
Auf jedem Fall in keinem kleinen Raum. Kathedrale kam mir als Begriff in den Sinn. Eine Kathedrale der Finsternis, mit einer leuchtend grünen, blinkenden Oberfläche auf dem Boden, auf der die kleine Peewee Russell hockte wie in einer Petrischale.
Ich starrte wieder an die nichtvorhandene Decke. Das Gesicht einer Frau schob sich in mein Blickfeld.
»Another Day In Paradise.« begrüsste sie mich.
Ich stieß vor Schreck nur einen erstickten Laut aus.
Die Frau war groß. Nein. Das traf es nicht.
Die Frau war riesig. Über zwei Meter groß. Sie trug eine Latzhose aus grobem Jeansstoff, Arbeitshandschuhe und ein Holzfällerhemd, welches sie hochgekrempelt hatte. Ihr langes, dunkles Haar wallte um ihr längliches, hübsches, aber auch irgendwie derbes Gesicht.
»Hey.« sagte ich. »Wie gehts denn so?«
»The Roof Is Leaking« antwortete die Riesin und deutete mit dem Daumen nach oben. Was einerseits »Alles in Ordnung« oder eine Richtungsangabe bedeuten konnte. Aufgrund ihrer Aussage ging ich einfach mal vom Letzteren aus.
»Wo sind wir hier?« fragte ich.
Die Riesin kam so unvermittelt näher, dass ich zusammenzuckte. »Behind The Lines.« flüsterte sie mir ins Ohr.
»Oh-kaay.« hörte ich mich gedehnt antworten. Die Riesin schien auf den ersten Blick nicht die Hellste zu sein.
»Wie heisst du?« fragte ich sie.
Sie deutete auf den Latz ihrer Hose. Darauf waren vier binäre Ziffernfolgen gestickt. Ein Nerd wie ich konnte die Binärzahlen leicht dekodieren.
01010000 = P
01001000 = H
01001001 = I
01001100 = L
»Phil?« riet ich. »Dein Name ist Phil?«
Die Riesin nickte bejahend. Sie klopfte sich auf gestickten Zahlen auf dem Latz.
»Don’t Loose My Number.«
»Mach ich nicht.« Ich überlegte: Don’t Loose My Number ... Another Day In Pardise ... Wo hatte ich das schon einmal gehört? Ich bin zwar kein Kind der Achtziger, aber auf den Weg zur Schule hatte meine Ziehmutter immer diese Sender mit 80er Jahre Musik gehört.
Billy, Billy, Don't you lose my number. Cause you're not anywhere that I can find you …
»Könnte es sein, Phil, dass du dich nur in Form von Songtiteln von Phil Collins verständigen kannst?«
Phil grinste breit. »Inside Out« sagte sie, was wohl soviel wie ›Du verstehst mich.‹ bedeuten sollte.
»Aber warum nicht die Beatles, oder die Stones? Wieso ausgerechnet den King der Supermarktmusik?«
»All Of My Life.« erklärte sie achselzuckend. So war es nun mal.
»Okay, Phil. Das habe ich jetzt kapiert. Nächster Punkt. Wo sind wir hier?«
Wieder kam sie näher und flüsterte in mein Ohr. »Behind The Lines«.
Ich nahm ihre Hände. »Ich weiß Phil, das hast du schon gesagt, aber wo genau ist das?«
Plötzlich wechselte die Farbe des blinkenden Quadrates unter uns von grün auf blau.
Phil riss sich los und schüttelte den Kopf. Dann sprang sie auf. Wieder deutete sie mit dem Daumen zur Decke. »The Roof Is Leaking« flüsterte sie heiser. Dann rannte sie zurück in die Dunkelheit.
»Phil!« rief ich ihr nach. »Lauf nicht weg!« Doch es war schon zu spät. Die Dunkelheit hatte sie bereits verschluckt. Ich lauschte. Nichts war zu hören.
Plötzlich begann das blaue Quadrat unter mir sich zu bewegen. Es begann nicht zu zittern, oder zu beben. Es begann sich einfach zu bewegen. Ein Surren war zu hören, doch es klang nicht metallisch nach einem Seilzug wie bei einem Fahrstuhl. Es klang künstlich. Elektronisch.
Der Fahrstuhl bugsierte mich in einen kleineren Raum. Decke, Wände und Boden waren hier blau.
An weißen runden Tischen saßen schwarz gekleidete Männer und Frauen auf weißen Stühlen. Die Männer trugen Motorradkluft, die Frauen enge, kurze Kleider. Erwartungsvoll sahen sie mich an. Ich stand etwas erhöht. Das Quadrat auf dem ich stand schwebte etwa einen Meter über dem Boden und war nun ein Podest.
Rechts von mir, am Rand des Podests, stand Lisa Arnold.
Sie war nackt und nass. In ihrem Haar klebte Seetang. Ihr Körper wies zahlreiche Schnittwunden auf. Sie sah aus wie eine Wasserleiche. Seewasser tropfte von ihrem Körper auf das blaue Podest.
Sie war eine Wasserleiche.
Sie starrte mich durch nasse Haarstähnen an. Dann bemerkte ich, dass sie an mir vorbei zum anderen Ende des Podests sah. Ich drehte den Kopf.
Dort stand eine weitere Frau mit kurzem, blondiertem Haar. Sie trug einen langen, schwarzen Ledermantel, Lederhose. Schaftstiefel. Weiße Bluse.
Von irgendwoher setzte plötzlich Gitarrenmusik ein. Dann das Schlagzeug. Die Frau in schwarzem Leder begann mit einer angenehmen Alt-Stimme zu singen:
»Du hast mir eine schlimme Zeit beschert. Hast versucht mich zu verletzten. Aber nun weiß ich es …«
Ich drehte wieder den Kopf. Offenbar meinte sie damit Lisa. Diese sagte nichts. Starrte die Frau in Leder nur wütend an. Ich erkannte ihre Stimme. Es war Annie Lennox. Ihrer Erscheinung nach zu Urteilen, waren Lisa und ich wieder in einem Musikvideo versammelt worden.
Annie Lennox passierte mich. Ich wollte sie ansprechen, doch Annie hob warnend die Hand. »Zu dir komme ich gleich, Schätzchen.« Sie sah mich dabei nicht an, sondern fixierte weiterhin Lisa. Sie fuhr mit ihrem Gesang fort:
»Dorn in meinem Auge. Du weißt, das ist alles was du jemals gewesen bist.« Sie stand nun vor Lisa. Mit einer zärtlichen Geste zupfte Annie Lennox ein wenig Tang aus Lisas Haar. »Ein Haufen voller Lügen. Du weißt, das ist alles was es war.« Nun streichelte sie mit ihrem Handrücken Lisas Gesicht. Angewidert drehte diese ihr Gesicht beiseite. Annie Lennox hielt inne. » Ich hätte es besser wissen müssen. Ich habe dir vertraut. Ich hätte es besser wissen müssen. Doch ich bekam, was ich verdient habe.«
Lisa starrte Annie an. Endliche sprach sie: »Du hast mich gefunden. Nun bring es zu Ende.«
Annie Lennox hob eine Hand zur Faust. Sofort verstummte die Musik. Alle Statisten an den Tischen erstarrten in ihren Bewegungen. Eine der Frauen verlor in dieser eingefrorenen Haltung das Gleichgewicht und stürzte um wie eine gefällte Statue. In der plötzlichen Stille hörte man nur Lisas Atem und die auf das Podest fallenden Wassertropfen aus ihrem nassen Haar.
Annie Lennox drehte sich zu mir um. Aber es war natürlich nicht die echte Annie Lennox. Es war ›Mutter‹.
»Wie mir scheint, habe ich auf das falsche Pferd gesetzt.« Sie kam zu mir herüber und streichelte mir die Wange. Ihre Haut fühlte sich kalt an. »Ich hätte sie anstelle von Lisa im Spiel lassen sollen, Miss Russell.«
»Ich wusste noch gar nicht, dass ich draussen war.« antwortete ich mutiger, als ich mich eigentlich fühlte.
»Ihre naive Art mag ich so an ihnen, Miss Russell.« Sie nickte mir mitfühlend zu. »Sie haben durch den Taser einen schweren Herzinfarkt erlitten. Sie wurden im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Die Ärzte kämpfen um ihr Leben, sind sich aber eigentlich sicher, dass sie die nächsten 48 Stunden nicht überleben werden.«
Ich schluckte und fasste mir automatisch an die Brust.
Ich fühlte mich gut. Vollkommen gesund. Aber ich war ja auch im Stream.
Okay. Ich liege im Koma und sie tropft den Boden voll. Was nun?« fragte ich.
›Mutter‹ grinste.
»Mir ist da gerade ein wunderbarer Einfall gekommen!«
»Nein!« schrie Lisa, die offenbar ahnte, was ›Mutter‹ vorhatte. ›Mutter‹ klatschte in die Hände.
Mich beschlich ein verdammt mieses Gefühl.
F … FFF … U … KK …
FF … KK … C … K …
F … U … C … K!
F … UCK!
Irgendetwas klappte meine Schädeldecke auf, griff in den nun offenen Kopf hinein, umfasste mein Gehirn und riss es mit einem Ruck heraus wie eine glitschige Rübe.
Alles hörte einen Moment lang auf.
Mein Gehirn fuhr wieder hoch.
Doch es war nicht mein Gehirn.
Erinnerungen wischten an mir vorbei wie Schnellzüge.
Wilder Sex.
Mit Männern jeden Alters.
Schwänze dringen in mich ein.
Manchmal sind es zwei.
Nadeln in meinen Venen. Blitze im Kopf als das Koks die Nasenscheidewand hinaufreitet.
Ein müder Mann in einem Laborkittel.
(»Vater, bitte.«)
(»Deine Mutter ist ungehalten.«)
(»Sie ist keine verdammte Göttin, Dad! Sie lässt nur alle glauben, dass es so ist!«)
(»Die Entscheidung ist gefallen.«)
Ein Messingschild an einem Haus.
Ravenwood
(»Meine Leben ist vorbei.«)
Schwimmen im Pool. Ein riesiges Mädchen in Latzhosen.
Rauchen im Gebüsch.
(»Du bist die einzige, die mich versteht Phyllis.«)
Das große Mädchen grinst breit.
(»Against All Odds«)
Dutzende von Leichen, aufgebahrt, die Körper bedeckt von weißen Laken. Das große Mädchen ist eine von ihnen.
Ein Techniker sieht von einem Bildschirm auf.
(Sie … Sie ist hier drin.)
Rennen durch die Nacht. Ein Mobiltelefon krampfhaft in der Hand haltend.
(»Wage es nicht!«)
(»Tut mir leid, Dad.)
Tut mir leid.
Leid.
L …
»Miss?«, fragte die Stewardess.
Ich blinzelte.
»Was?«
»Möchten sie noch einen Champagner?«
Ich musste ziemlich blöd aus der Wäsche kucken, denn die Stewardess musterte mich besorgt.
»Ja, warum nicht.« murmelte ich schließlich. Die Stewardess nickte und schenkte mir nach.
Ich starrte auf mein Glas. Ich bemerkte etwas an mir hängen.
Titten. Ich hatte Titten.
Natürlich hatte ich schon vorher welche, aber nicht solche. Automatisch wollte ich sie anfassen, doch in der Bewegung fiel mir ein, dass dies vielleicht seltsam aussehen würde. Ich machte daher mit der Hand eine dankende Geste und schnalzte mit der Zunge.
»Danke, Teuerste.«
»Aber gern, Miss Arnold. Wir landen in wenigen Minuten.«
Arnold. Lisa Arnold. Ich steckte also wirklich in dem Körper der Wasserleiche.
Verfluchte Scheiße. Wie war so etwas möglich?
Ich konnte es mir nicht erklären. Und es gefiel mir nicht, Dinge nicht erklären zu können. Doch im Moment war das wichtigste die Welle zu reiten und nicht vom Brett zu fallen.
Fuck. Hatte ich das wirklich gerade gedacht?
Alles fühlte sich so seltsam an. Alles dachte sich seltsam. Ich fühlte mich gegen meinen Willen in ein Kleid gesteckt, dass nicht richtig saß.
Ein sanfter Ruck riss mich aus meinen Gedanken.
Die Maschine hatte aufgesetzt.
Unter meinem Sitz fand ich eine Handtasche.
Es war eine schwarze Birkin Bag. Ich öffnete die Tasche und fand darin eine Sonnenbrille, Tampons, eine Flasche Aspirin, eine Flasche Wasser, Kaugummi und eine schwarze American Express Centurion Kreditkarte. Es war eine Firmenkreditkarte von sweepr.net. Sie war auf den Namen Lisa Arnold ausgestellt.
Ich würde also nicht verhungern und ich hatte alles was eine Frau von heute so braucht.
Bis auf ein Mobiltelefon oder ein iPad.
Ohne eines dieser Utensilien fühlte ich mich immer noch nackt.
Die Maschine kam zum stehen.
Ich sah aus dem kleinen Fenster der Gulfstream.
Auf dem Rollfeld vor der Maschine stand eine schwarze Stretch-Limousine.
Das Déjà-vu versetzte mir einen kleinen Stich. Ich war mir der Ironie durchaus bewusst. Alles an dieser Situation erinnerte an meinen gescheiterten Versuch mit Katherine Williams zu sprechen.
Bevor ich in den Stream fiel.
Bevor ›Mütterchen‹ mich in den Körper von Lisa Arnold steckte. Das alles schien tausend Jahre her zu sein.
Wie viel Zeit mochte mittlerweile vergangen sein? Ich wusste es nicht. An meinem/ihrem linken Handgelenk befand sich ein Schmuckarmband. Keine Uhr. Ich überlegte, ob ich die Stewardess nach Datum und Uhrzeit fragen sollte. Ich ließ es bleiben.
Am Terminal las ich einen Schriftzug:
Logan Airport.
Ich war also in Boston.
»Im Namen der Crew wünsche ich ihnen einen guten Tag, Miss Arnold.« sagte die Stewardess zum Abschied, als ich die fragile Gangway hinunter stakste. Der Fahrer der Limousine war ausgestiegen und stand wartend an der hinteren Wagentür. Daneben lehnte ein Mann mit schmalem Schnurrbart und einem gelangweiltem Gesichtsausdruck. In einer Hand hielt er einen Papierumschlag. Als ich näher kam, reichte er ihn mir.
»Hier ist der Bericht, den sie angefordert haben.« sagte er und wandte sich zum gehen.
»Äh, danke« sagte ich. Der Mann hob zur Erwiderung im gehen die Hand. »Keine Ursache. Rechnung kommt.«
»Alles klar.« murmelte ich. Der Fahrer der Limousine öffnete mir die Tür.
»Willkommen in Boston, Miss Arnold.«
Ich nickte ihm zu und stieg ein. Er schloss die Tür ging um den Wagen und setzte sich auf den Fahrersitz. Ich wartete darauf, dass er losfuhr. Doch der Wagen bewegte sich nicht.
»Wohin, Miss Arnold?« fragte er über die Sprechanlage. Ich suchte nach dem Schalter für die Trennscheibe. Ich fand ihn. Die Scheibe senkte sich.
»Kennen sie das Ziel nicht?«, fragte ich den Fahrer. Er hatte ein südländisches Aussehen. Er schüttelte den Kopf und lächelte freundlich.
»Nein, Miss Arnold. Sie gaben in ihrer Bestellung an, dass sie das Ziel erst bei Fahrtantritt bekannt geben würden.«
»Alrighty.«, erwiderte ich. »Einen Moment.«
Denk nach! Eher aus Verlegenheit als aus Überlegung öffnete ich den Umschlag, den mir der Schnauzbart überreicht hatte.
Der Umschlag enthielt ein Dossier über einen gewissen Andrew Curkow. Er war Technikjournalist. Ich erinnerte mich Dunkel daran, ihm einmal auf einer Technikkonferenz in San Francisco begegnet zu sein. Rundlich. Nett. Mit Hut. Aus irgendeinem Grund hatte Lisa Arnold ein Detektivbüro damit beauftragt Andy Curkow ausfindig zu machen. Offenbar hielt er sich zur Zeit in einer Hütte im Norfolk County auf. Eine genaue Adresse gab es nicht, nur geographische Angaben in Längen und Breitengraden. Ich reichte dem Fahrer die Akte.
»Da möchte ich gern hin.« sagte ich. Der Fahrer nickte und gab die Geodaten in das Navigationssystem der Limousine ein.
»Alles klar, Miss Arnold.« Er gab mir die Akte zurück.
Ich nahm sie und seufzte.
»Hoffentlich haben sie ein paar Antworten für mich, Mr. Curkow.« murmelte ich.
Andy hatte geraden den zweiten Fisch für sein Mittagessen an der Angel, als er das Brummen einer Propellermaschine hörte.
Wie jeden Tag, so war er auch heute nach dem Frühstück von der kleinen Hütte durch den Wald zum Fluss gewandert, hatte sich ans Ufer gesetzt und die Angel ausgeworfen.
Es hatte ein paar Tage gebraucht, doch mittlerweile begann er sich an die radikale Abkehr von seinem bisherigen Leben zu gewöhnen. Er hatte ein paar bescheidene Rücklagen und glaubte mit ihnen mindestens ein Jahr durchhalten zu können. Dann wollte er soweit sein, sich vollkommen selbst versorgen zu können. Sein Großvater hatte ihm als Junge das Jagen und Fischen beigebracht. Vieles davon glaubte er vergessen zu haben, doch wie mit dem Fahrradfahren, schien man diese einmal erlangten Kenntnisse nicht vollkommen zu verlieren.
Er wartete schon darauf, dass ihn der Fisch bald über sein würde, doch bisher war dies nicht der Fall. Die Hütte selbst hatte seinen Großeltern gehört. Hinter dem Haus gab es einen kleinen Gemüsegarten, den Andy natürlich erst einmal in Schuss bringen musste. Aber mit ein wenig Einsatz rechnete er im Herbst schon mit dem ersten selbstgezogenem Gemüse. Andy hatte an Gewicht verloren und fühlte sich so kräftig und ausgeruht wie schon seit Jahren nicht mehr.
Sein Redakteur beim National Inquisitor, Leo Laporte vom ›Macbreak Weekly‹ Podcast und vor allem Dan Benjamin mit dem er zusammen den Podcast ›The Curkow Almanac‹ für Benjamins 5by5 Network produzierte, waren nicht gerade begeistert, als er ihnen allen verkündet hatte, dass er aus persönlichen Gründen um eine längere Auszeit bat. Die wahren Gründe hatte er für sich behalten.
Ich muss mich verstecken. Vor einer bösartigen, künstlichen Intelligenz. Diese hat im übrigen gerade das Zeitalter der Singularität eingeleitet. Und diese KI trachtet mir nach dem Leben. Und daher ist mein Leben. Korrektur: Vermutlich unser aller Leben, wie wir es kennen, vorbei.
Das Brummen des Flugzeugs wurde lauter. Nun, das war nicht weiter beunruhigend. Oft patrouillierte ein Flugzeug der Parkverwaltung über dem Waldgebiet, um nach möglichen Waldbränden Ausschau zu halten. Trotzdem wurde Andy das ungute Gefühl nicht los. Seit dem … Vorfall in Maiden hatte Andy sich angewöhnt mehr auf dieses Bauchgefühl zu hören. Er holte die Angel ein, löste den Fisch vom Haken, warf ihn zurück in den Fluss und packte hastig sein Zeug zusammen.
Er war bereits auf halbem Weg zur Hütte, als ihm einfiel, dass es gestern Abend geregnet hatte.
Die Waldbrandgefahr lag bei nahezu Null.
Er begann schneller zu laufen.
Die Limousine bog schaukelnd in den gefühlten hundertsten Feldweg ein. Laut Navigationssystem waren wir nur noch wenige Kilometer vom Aufenthaltsort von Andy Curkow entfernt.
Ein Flugzeug brauste über die Limousine hinweg. Ich blickte aus Lisa Arnolds Augen durch das getönte Dachfenster der Limousine.
Das war kein Flugzeug. Es war eine Drohne. Etwas an seinen Tragflächen reflektierte die Sonne.
Eine mit Raketen bestückte Drohne.
»Geben sie Gas« rief ich dem Fahrer zu.
Andy trat aus dem Wald auf den grasbewachsenen Hügel, auf dem sich ein schmaler Weg zur Hütte hinabschlängelte. Das Flugzeug kreiste im weiten Bogen über der Hütte.
Scheiße. Das ist kein Flugzeug, dachte er noch, dann explodierte die Hütte seiner Großeltern in einem gewaltigem Feuerball.
Auf den Lichtblitz folgte schon die Druckwelle, die Andy fasst von den Füßen riss. Dann erst hörte er den Knall.
Gottverdammt, dachte er. ›Mütterchen‹ hatte ihn gefunden.
Einen Moment lang sah ich die Hütte links neben dem Feldweg, dann verschwand sie in einem Lichtblitz.
»Fuck!« schrieen der Fahrer und ich gemeinsam.
Er trat hart auf die Bremse. Wäre ich nicht angeschnallt gewesen, hätte ich mir vermutlich an der Trennscheibe den Schädel eingeschlagen. Aufgewirbelter Sand senkte sich langsam um das Fahrzeug wie Bodennebel. Ich löste den Gurt und stieg aus.
Bevor ich die Tür wieder schließen konnte, setzte der Fahrer der Limousine zurück.
»Fuck! Fuck! Fuck!« hörte ich ihn immer wieder schreien.
»Warten sie!« rief ich, doch es war schon zu spät. Wieder wirbelte Staub auf.
Hustend sah ich mich um. Auf einem Hügel am Waldrand sah ich eine Gestalt. Dem Hut und der Leibesfülle zu urteilen musste es sich um Andy Curkow handeln. Mir fiel auf, dass er abgenommen hatte.
Gut für ihn, dachte ich bei mir und winkte ihm zu.
Andy Curkow erstarrte, als er mich sah. Dann begann er heftig zu gestikulieren.
»Was?« rief ich fragend. Er deutete gen Osten. Ich folgte seinem Blick. Die Drohne hatte gewendet und flog nun genau auf mich zu.
Als Andy die junge Frau erkannte, die aus der Limousine stieg, setzte für einen Augenblick sein Herzschlag aus.
Nein, dachte er. Nein, das kann nicht sein. Sie ist tot. Ich habe gesehen wie die Quadrocopter in der Serverhalle in Maiden sie in Stücke gerissen haben.
Doch da stand sie. Lisa Arnold. Schön und lebendig. Der Fahrer setzte die Limousine zurück. Lisa wurde kurz von einer Staubwolke eingehüllt. Dann sah sie ihn und winkte ihm zu. Etwas daran störte Andy. Es wirkte so, als würde sie ihn nicht richtig kennen. Sie wirkte nicht wie sie selbst.
Andy hörte ein Brummen. Die Drohne kam zurück. Sie flog auf Lisa und die im Rückwärtsgang dahin schlingernde Limousine zu.
Andy sah, wie sich eine weitere Lenkwaffe vom Flügel der Drohne löste.
Gottverdammt, dachte Andy. Vielleicht war Lisa Arnolds Auferstehung von den Toten nur von kurzer Dauer.
Ich sah, wie die Lenkwaffe auf mich zu raste.
Der Tod hat mich gefunden, dachte ich noch, dann sauste die Rakete über mich hinweg und traf die Limousine, etwa fünfzig Meter hinter mir.
Ein ohrenbetäubender Knall und ein heißer Orkan. Ich flog durch die Luft und schlug hart, gefühlte zwei dutzend Meter, wieder auf dem Boden auf.
Ich schmeckte Dreck und Gras. Mein Ohren dröhnten.
(Steh auf.)
Keine Lust. Ist doch schön hier.
(Steh auf, wenn dir dein Leben lieb ist!)
Ich erhob mich mit zitternden Knien. Ich versuchte mich zu orientieren, versuchte die Position der Drohne ausfindig zu machen. Sie flog einen weiten Bogen. Die Unterseiten der Tragflächen waren leer. Die Drohne hatte ihr Pulver verschossen.
(Falsch. Du vergisst die Drohne selbst.)
Erst jetzt erkannte ich die Stimme in meinem Kopf. Es war die Stimme von Rachel Garrett. Ich wusste nicht, was diese Stimme in meinem Kopf zu suchen hatte, aber ihre Argumentation war durchaus stichhaltig.
So schnell ich konnte, rannte ich in Richtung Wald, auf Andy Curkow zu.
Nachdem die Drohne die Limousine erledigt hatte, blieb für sie nur noch ein offensichtliches Ziel übrig.
Lisa Arnold war durch die Explosion durch die Luft geschleudert worden. Das Rückenteil ihres Business Kostüms und ihre Hosen rauchten. Sie rappelte sich mühsam auf und begann auf ihn zu zu rennen.
Andy spürte ein vertrautes Prickeln in den Beinen. Die in ihm aufsteigende Panik wollte ihn zur Fluch bewegen. Doch Andy blieb.
Ich habe sie einmal in Stich gelassen. Ein zweites Mal passiert mir das nicht, dachte er grimmig.
Die Drohne hatte ihre Wende abgeschlossen und hielt nun genau auf Lisa und Andy zu.
Mit einer grazilen Behändigkeit, die Andy an jungen Menschen immer so bewundert, und die er auch dann nicht besessen hatte, als er selbst jung gewesen war, rannte Lisa den Hügel hinauf.
Die Drohne war noch etwa eine halbe Meile entfernt. Schwer atmend erreichte Lisa ihn.
Sie wollte etwas sagen, hatte aber keine Luft dazu. Andy packte sie am Arm und rannte mit ihr tiefer in den Wald.
Lisa Arnolds Körper war eindeutig trainierter, als mein eigener, aber Andy Curkow bewegte sich für sein Alter und Gewicht auch nicht schlecht.
Hinter uns hörte ich ein Dröhnen. Die Drohne ging in den Sinkflug. Das Dröhnen wurde lauter … und dann noch lauter.
»Laufen sie!« fuhr mich Andy an. Ich versuchte noch einen Zahn zuzulegen. Dann hörte ich ein kreischendes Geräusch hinter uns, als sich die Drohne durch Reihen von Baumstämmen schälte.
Wieder gab es einen Knall und wieder explodierte etwas, doch dieses mal war es weniger intensiv. Etwas traf mich am Arm und zerriss mir den Ärmel. Wir wurden zu Boden geschleudert. Eine Propellerblatt flog scharf über unseren Köpfe hinweg, fällte ein paar schmale Bäume, die wie angeschossene Soldaten langsam zu Boden sanken und blieb dann im Stamm einer mächtigen Eiche stecken.
Dann war es still.
Ich sah runter und blickte auf ein Doppelkinn. Ich lag bäuchlings auf Andy Curkow.
»Hi.« sagte ich. Er bewegte sich stöhnend. Sein Koteletten kitzelten in der Nase.
»Hi.« sagte er. »Sind sie verletzt?«
Ich begutachtete die Schramme am Arm. Die Wunde brannte, war aber nicht besonders tief.
»Werd’s überleben.« sagte ich knapp.
»Sie sind offenbar ganz gut darin.« sagte Andy Curkow.
»Wie meinen sie das?«
»Das beantworte ich ihnen gern.« ächzte er. »Doch lassen sie uns dafür doch lieber aufstehen. Ihr Knie liegt genau auf … auf einer empfindlichen Stelle. Auuuhhh!« schrie er, als ich das Knie bewegte. Vorsichtig rollte ich von ihm herunter. Wir lagen einen Moment so da. Dann rappelte ich mich auf, reichte ihm eine Hand und half ihm auf.
»Danke.« sagte er. Er stand einen Moment breitbeinig da, die Hände auf die Knie gestützt. So wirkte er älter, als er war. Dann sah er sich um, fand seinen Fedora und setzte ihn auf.
Er sah mich an und umarmte mich mit festem Griff.
»Mein Gott, ich bin so froh, dass sie Leben!« sagte er. Seine Stimme zitterte leicht.
Ich wollte ihm gerade erklären, dass es sich offensichtlich um eine Verwechslung handeln musste, als mir wieder in den Sinn kam, dass ich im Körper von Lisa Arnold steckte.
»Sie kennen Lisa?« fragte ich daher.
»Natürlich kenne ich sie!« Er ließ mich los. »Erinnern sie sich nicht? Wir waren zusammen in Maiden. Im Rechenzentrum.«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie waren mit Lisa Arnold vielleicht dort. Nicht mit mir. Ich stecke zwar im Körper von Lisa, ich bin aber nicht sie.«
»Was?« fragte er ungläubig.
»Glauben sie mir. Ich bin nicht Lisa. Mein Name ist Peewee. Peewee Russell. ›Mütterchen‹ hat mich in den Körper von Lisa gesteckt.«
»›Mütterchen‹« krächzte Andy. Er begutachtete die brennenden Wrackteile. »Wie hat sie mich gefunden?«
Über diese Frage hatte ich auch schon nachgedacht.
»Ich fürchte, das ist meine Schuld.« Er hob überrascht die Brauen.
»Lisa Arnold hat sie über ein Detektivbüro suchen lassen. Ihr Bestimmungsort wurde dabei nie digital erfasst. Doch ich habe nicht bemerkt, dass der Fahrer die Adresse die der Detektiv ermittelt hat in das Navigationssystem der Limousine übertragen hat. Damit hatte ›Mütterchen‹ alle Information die sie brauchte um eine Drohne umzuprogrammieren und Jagd auf sie zu machen.«
»Sie sagen ihr Name ist Peewee Russell?« fragte er.
»Yep.«
»Sie haben mit Richard Baxter zusammen sweepr.net gegründet?«
»Yep.«
»Soweit ich weiß, gehört Peewee Russell zu den besten Hackern der Welt. Wie kann ihnen ein solcher Fehler unterlaufen?«
»Ganz ehrlich?« Andy nickte grimmig.
»Ja, ehrlich.«
»Diese beschissene K.I. hat bereits mehrfach versucht mich zu töten. Sie hat es bereits geschafft meinen Körper ausser Gefecht zu setzen. Jetzt hat sie mich auch noch in einen anderen Körper gesteckt.« Ich sah an mir herunter. »Zugegeben. Es ist ein recht attraktiver Körper, aber vielleicht können sie verstehen, dass mich so eine Erfahrung intellektuell nicht gerade beflügelt?!«
»Ich kann es mir wohl nicht vorstellen, aber ich kann es zumindest versuchen. Was schlagen sie vor, was wir nun tun?«
»Ich finde, es ist Zeit, dass wir ›Mütterchen‹ gehörig in den Arsch treten.«
Andy schluckte. Sah mich an und wendete den Blick dann ab.
»Das hat Lisa auch gesagt. Minuten später sind hunderte von Qudrocoptern über sie hergefallen. Und ich … Ich habe sie im Stich gelassen und bin gerannt wie der Feigling, der ich nun einmal bin.« Er stand auf und stapfte davon.
Ich sprang auf und folgte ihm.
Er ging die Schneise der Verwüstung entlang zur Hütte zurück, oder besser zu dem, was von der Hütte noch übrig war. Hilflos zeigte er auf den schwelenden Bretterhaufen.
»Sehen sie sich das an!« rief er. »Diese Hütte hat mein Großvater mit seinen eigenen Händen gebaut. Diese verdammte …« Er schluchzte. Seine Knie wurden wieder weich und er kniete sich wieder ins Gras.
»Hey.«, sagte ich, hockte mich neben ihn hin und legte ihm sanft eine Hand auf die Schulter. »Sie haben recht. Wir sind nicht in der Position, um ›Mütterchen‹ in den Arsch zu treten.«
Ich überlegte. Es wurde Zeit einer Frage nachzugehen, die mich schon seit meinem ersten Besuch im Stream umtrieb. Und ich vermutete, dass es neben ›Mütterchen‹ nur eine Person gab, die mir diese Frage beantworten konnte. Ich stand auf und streckte Andy die Hand entgegen, um ihm aufzuhelfen.
»Kommen sie.«, sagte ich. Er sah mich müde und zweifelnd an. »Wohin?«
»Wir müssen die Variablen ändern.« erklärte ich. »Und dafür müssen wir einer Irrenanstalt in Princeton einen Besuch abstatten.«
Trapp. Trapp.
Klack. Klack.
Schlurf. Schlurf.
Lisa hörte Schuhe. Schuhe auf Asphalt.
Lisa fühlte Wärme. Wärme gespeichert im Asphalt.
Lisa fühlte Nässe. Die Nässe von Nebel und See.
Sie schlug die Augen auf.
Sie lag mitten auf einer Brücke, eingehüllt in Nebel.
Sie kannte diese Brücke.
Sie war von ihr geworfen worden.
Golden Gate Bridge.
Um sie herum war nur Asphalt der nach ein paar Metern im Nebel verblasste. Lisa spuckte Blut auf die vom Tag noch warmen Teerdecke.
Ihre Fesseln waren verschwunden, aber ansonsten war sie im gleichen Zustand, wie damals, als Spyder und Donkey Kong sie nackt und blutend über das Geländer der Brücke geworfen hatten.
Das Geräusch von Schuhen auf Asphalt wurde lauter. Sie drehte den Kopf.
Eine Gruppe von Menschen kam langsam auf sie zu.
Nein. Es war keine Gruppe. Es war eine Wand.
Eine Wand von Menschen. Langsam näherte sie sich ihr. Die Menschenwand reichte vom Fußgängerweg auf der einen Seite, über die Fahrspuren bis zum Fußgängerweg auf der gegenüberliegenden Seite. Hunderte, vielleicht tausende Menschen. Sie ginge im gemächlichem Schritt. Nicht wie Zombies, mehr wie eine Prozession und sie kamen direkt auf sie zu.
Sie sehen nicht so aus, als würden sie sich um dich scheren. Sie werden einfach über dich hinweg trampeln.
Fuck, dachte Lisa. Zitternd erhob sie sich. Die Menschenwand war noch etwa fünf Meter entfernt. Durch Nebel bekam ihr langsamer Gang ein dumpfen, hohlen Klang. Lisa stolperte zum Geländer. Sie hatte es gerade erreicht, als die ersten Menschen sie passierten. Wie vermutet, würdigten sie sie trotz ihres Zustand und ihrer Nacktheit nicht eines Blickes.
Sie gingen einfach an ihr vorbei und verschwanden nach ein paar Metern im Nebel. Ihnen folgten, dicht and dicht, weitere Menschen. Lisa konnte kein Ende der Menschenmasse ausmachen. Es musste sich wirklich um tausende handeln.
Eine Frau in einer weißen Bluse streife ihren Arm. Lisas Blut hinterließ an dem Ärmel der Bluse einen roten, verschmierten Fleck. Die Frau achtete nicht darauf.
Ein Kind von vielleicht zehn Jahren streifte sie ebenfalls. Lisa versuchte weitere Kollisionen zu vermeiden, doch bei der Masse von Menschen, war dies kaum möglich. Sie bemerkte, wie sie das Geländer losließ. Wieder ein Stoß. Er war nicht gewollt, auch nicht stark. Es führte nur dazu, dass Lisa Schritt für Schritt weiter gedrängt wurde. Sie blieb stehen, kollidierte weiter mit Menschen. Es kam zu einem Stau. Immer mehr Menschen drängten von hinten. Schließlich musste sie den Widerstand aufgeben. Die Masse schob sie vorwärts.
»Wohin gehen wir?« fragte Lisa einen Mann neben sich. Er antwortete nicht. Er starrte nur geradeaus. Lisa sah ebenfalls nach vorn. Etwa fünf oder sechs Reihen vor ihnen konnte sie sehen, wie die Köpfe der Menschen plötzlich verschwanden. Sie wurden nicht vom Nebel geschluckt. Es schien, so als würde ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen.
Vier Reihen vor ihnen.
Nun konnte Lisa sehen, dass die Menschen fielen. Die Brücke hörte einfach auf. Die Menschen traten über den Rand … und stürzten lautlos in die Tiefe.
Lisa kämpfte sich wieder an den Rand zum Geländer. Sie klammerte sich fest. Doch schon nach Minuten musste sie dem Druck der Masse nachgeben. Sie stolperte immer näher dem gähnendem Abgrund entgegen. Neben ihr fielen stumm die Menschen in das gähnende Nebelloch hinab, wie Lemminge. Am Rand stemmte Lisa die nackten Füße in den Asphalt.
Es half nichts. Der Druck wurde zu groß.
Sie wurde über den Rand gedrückt.
Sie fiel.
»NEIN!«, schrie Lisa.
Dann wurde es ihr klar.
Sie hatte geträumt.
Sie lag auf einem grün schimmernden Quadrat inmitten von Dunkelheit.
Sie war immer noch im Stream.
Das letzte, woran sie sich erinnern konnte, war dass sie in einem Flugzeug gesessen hatte.
Ich habe Katherine Williams kontaktiert. Sie hat mir eine Maschine geschickt. Ich war auf dem Weg nach Boston, als …
Als Mütterchen mich erwischt hat.
Sie hat mich aus der Luft gekascht wie ein Schmetterlingssammler.
Dann … das 80er Jahre Video im Stream.
Eines musste sie Mütterchen lassen. Sie hatte Sinn für Ironie.
Die Andere war da gewesen. Die Bohnenstange mit den blonden, zerzausten Haaren. Peewee.
Peewee Russell.
Lisa fuhr sich mit den Händen durch ihr zerzaustes Haar.
Shit. Was ist mit meinen Haaren passiert? Das war nicht mehr ihr Haar. Sie betrachtete ihre Hände. Blass und schmal und mit zerkauten Fingernägeln.
Ihre Beine waren kurz, ihre Rundungen verschwunden.
HAB ICH KREBS?, überlegte sie einen Moment lang. Dann wurde es ihr klar.
»Mir ist da gerade ein wunderbarer Einfall gekommen!« hatte Mütterchen gesagt.
Sie hat es wirklich getan. Sie hat unsere Gehirne vertauscht.
»Oh Fuck.« sagte Lisa leise.
»Das kannst du laut sagen, Babe.« sagte eine Stimme.
Lisa sah hoch.
Ein paar Meter entfernt hockte eine Gruppe von Jugendlichen um ein Lagerfeuer herum.
Zwei Mädchen. Zwei Jungen. Alle schwarz. Sie starrten wie hypnotisiert in die Flammen. Nur der eine, der sie angesprochen hatte, sah sie neugierig an.
Nun, eigentlich war es kein richtiges Lagerfeuer. Es bestand aus groben Pixeln und leuchtete grün.
Aber das waren doch …
(»Hey, lass meinen Knüppel los!«)
(»Voll cool. Voll auf die Zwölf!«)
(»Bitte. Tu mir nichts!«)
Lisa schluckte.
Es waren die vier Jugendlichen, die sie kaltblütig ermordet hatte.
Lisa blieb unschlüssig vor der Gruppe stehen.
»Hey, Babe. Was ist los?« fragte einer Jungen freundlich, mit besorgter Stimme. Wieder brauchte Lisa einen Moment. Dann wurde ihr klar, dass die Jugendlichen sie in ihrer neuen Gestalt als dürres Mädchen mit blonden, zerzausten Haaren und keinen Titten nicht erkannten.
Nicht erkennen konnten.
Bevor Lisa dem Jungen etwas erwidern konnte, rollte einer der Mädchen mit den Augen.
Schon komisch, dachte Lisa. Dabei habe ich ihr doch die Augen in die Höhlen gedrückt, bis sie platzten wie überreife Weintrauben. Jetzt wo sie sie wieder mit ihren Augen sah, wurde ihr bewusst, dass sie es nicht hätte tun sollen. Das Mädchen hatte sehr schöne, große, braune Augen.
»Du kannst vielleicht dämliche Fragen stellen, Malcolm. Sie sitzt mit uns hier in der Hölle, genau wie die Anderen.«
»Welche Anderen?« fragte Lisa. Das Mädchen deutete mit einem Kopfnicken hinter sich. »Wenn du weitergehst, wirst du weitere Feuer finden. Hunderte. Nein, Tausende. Sie sitzen wie wir um kalte, grüne Flammen herum und versuchen heraus zu finden, was mit ihnen passiert ist. Warum sie es verdient haben in der Hölle schmoren.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich wusste, dass ich in der Hölle lande. Zuviel Gras, zuviel rumgevögel.«
»Hey, Babe. Ich dachte, es hätte dir gefallen.«
»Ja, dachte ich auch.« pflichtete Morrison ihm bei.
»Haltet den Mund. Alle beide!« Die beiden Jungen schwiegen und starrten eingeschüchtert in die Flammen.
»Ich hatte mir immer vorgestellt, dass die Hölle so war wie in den Samstagnachmittag Cartoons. Glühend hell, heiss und das uns der Teufel mit einem Dreizack in den Hintern piken würde. Aber es ist das Gegenteil. Es ist Dunkel, kalt und einsam. Alles hier ist noch viel schlimmer, als in den Samstagnachmittag Cartoons.« Sie seufzte. »Naja, die sind ja auch für Kinder. Die vertragen die Wahrheit ja auch noch nicht so gut.« Mit diesen Worten starrte sie wieder in die Flammen. Lisa schien vergessen.
Diese blieb noch einen Moment lang stehen, dann ging sie weiter.
Das Mädchen behielt recht. Das Terrain hob sich sanft und endete dann abrupt an einer steil abfallenden Klippe. Lisa ging vorsichtig bis zum Rand und spähte hinab auf einen felsigen Küstenstreifen.
Auf ihm waren tausende von Lagerfeuern. Sie alle spiegelten die digitalen Sterne an dem schwarzen Nachthimmel. Das Meer war ein Brei dunkelblauer, sich sacht bewegender, grober Blöcke. Am felsigen Strand hockten um jede Feuerstelle Menschen. Jeweils ein halbes Dutzend. An einigen mehr, an anderen weniger.
»Wer sind all diese Menschen?« fragte sich Lisa selbst. Die dachte kurz darüber nach. Und bevor sie sich die Antwort geben konnte, sprach eine ihr sehr vertraute Stimme zu ihr.
»Against All Odds« flüsterte sie.
Die gehörte zu einer großen Frau in Latzhosen.
»Phil!« rief Lisa und umarmte die Frau. Lisas neuer Körper war kleiner. Sie reichte der riesigen Frau kaum an die Brust.
Diese versteifte sich und entzog sich Lisas Umarmung.
»We Wait And We Wonder.« sagte sie. Lisa trat einen Schritt zurück. Sie erkennt mich nicht. Sie weiß nicht, wer ich bin, dachte sie.
»Ich bin es. Lisa. Erkennst du mich nicht?« Phil schüttelte den Kopf. »I Cannot Believe It’s True.« sagte sie.
Klar, Phil. Wie solltest du das verstehen? Ich verstehe es ja selbst nicht.
Lisa wollte etwas sagen, wollte sich erklären, aber sie wusste nicht wie. Sie seufzte.
Sei einfach froh, dass Phil am Leben ist. Aber, war das wirklich der Fall?
»Wir sind tot, nicht war Phil? Genau wie all die Menschen dort unten an den Lagerfeuern. Sie sind alle tot.«
Phil legte einen Finger auf ihre Lippen und machte »Shht.« Lisa sah sie fragen an. »The Roof Is Leaking!« erklärte Phil. Sie packe Lisa am Arm und zog sie mit sich.
Widerstrebend folgte Lisa Phil auf einem schmalen Pfad, der die Klippe hinab führte. Als sie schließlich den Fuß der Klippe erreichten, wandte sich Phil abrupt nach Links.
»Hey!« rief Lisa. Phil hatte ihre Kräfte nicht unter Kontrolle. Bei dem plötzlichen Richtungswechsel hatte Phil ihr beinahe den Arm ausgekugelt.
»I Like The Way.«, grunzte sie Lisa nur zu und ging schnell weiter. Der Strand war nicht sandig, sondern bestand aus Fels. Lisa hatte im Dunkel Mühe die zahlreichen Spalten und Vertiefungen im Boden zu umgehen. Zweimal wäre sie beinahe mit dem Fuß in eine der Spalten geraten. Einmal zischte sie eine kleine digitale Krabbe aus einer mit Wasser gefüllten Vertiefung an. Sie hatte viereckige, glühende Augen und eckige Zangen, die sie mit einem elektronischem Schnalzen warnend gegeneinander schlug.
Sie passierten weitere digitale Lagerfeuer. Lisa atmete deren Rauch ein. Er roch nicht nach Holz, sondern scharf wie Ozon. Keiner der Menschen die sich an ihnen wärmten, schenkten ihnen weiter Beachtung.
Das rhythmische Donnern der Brandung war das einzige Geräusch. Die Felswand der Klippe war mit Höhlen durchzogen. Vor einer von ihnen brannte ebenfalls ein digitales Feuer. Zielstrebig dirigierte Phil sie darauf zu.
Eine einzelne, blonde Frau saß mit dem Rücken zu ihnen davor. Als sie Phil und Lisa kommen hörte. Drehte sie sich langsam um. Sie war sehr gutaussehend und trug ein schlichtes, graues Kleid aus grobem Stoff.
Sie sah Lisa an und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie stand auf und kam mit nackten Füßen langsam auf sie zu.
Sie wischte sich die Tränen aus den Augenwinkeln und lächelte Lisa an. »Entschuldige, bitte. Ich hatte nicht geglaubt, dass ich dich noch einmal wiedersehen würde. Auch wenn die Umstände dafür keine Guten sind.« Sie umfasste Lisas Gesicht mit ihren Händen und küsste sie leidenschaftlich. Ihre Lippen waren trocken und ihre Zunge vorsichtig fordernd. Als Lisa den Kuss nicht erwiderte, hielt die schöne Blondine inne.
»Du bist nicht Peewee.« sagte sie langsam und wich einen Schritt zurück.
»Nein.« sagte Lisa. »Ich meine, ich denke das dies ihr Körper ist, aber … ich bin nicht Peewee. Mein Name ist Lisa. Lisa Arnold.«
Plötzlich wurde Lisa von den Füßen gerissen. Phil wirbelte sie herum. »I Can Not Believe It’s True!« rief sie und drückte Lisa fest an sich. Phil wandte sich zu der Frau zu. »We Fly So Close« erklärte sie.
Lisa umarmte Phil nun ebenfalls.
»Es ist so schön dich wieder zu sehen, Phil.«
»Nun, dann ist es wohl an mir, mich vorzustellen.« sagte die Blondine. Sie hielt beschämt den Blick gesenkt. »Es tut mir leid, dass ich sie geküsst habe, Miss Arnold. Es war etwas, was ich tun wollte, sollte ich noch einmal Peewee Russell begegnen. Bitte entschuldigen sie.«
»Schon okay. Immerhin …« Hilflos zuckte sie mit den Achseln.« Nun, schliesslich ist dies hier Peewees Körper.«
»Aber wie ist das möglich?« fragte die Frau. Wie sind sie in ihren Körper geraten?« Lisa biss sich auf die Lippen. »Mütterchen.« erklärte sie mit leiser Stimme. » Es war ›Mütterchen‹.«
»Ich verstehe.« sagte die Frau und nickte bedächtig. Dann streckte sie Lisa förmlich die Hand entgegen. »Mein Name ist Rachel Garrett. Willkommen in der wirklichen Welt, Miss Arnold.«
level sieben
Zehn Jahre zuvor …
Als Katherine Williams zum ersten Mal mit Richard Baxter schlief, waren schon einige Dates vergangen.
Zu Katherines Überraschung waren sie nicht gleich übereinander hergefallen. Richard hatte sich an sie heran getastet. Stufe für Stufe. Schritt für Schritt. Nicht bedrohlich wie ein Raubtier, sondern wie ein Mann, der es ernst meinte.
Natürlich konnte sich Katherine da nicht ganz sicher sein. Kein Mann hatte es je ernst mit ihr gemeint.
Lügnerin. Wisperte eine Stimme in ihr. Einer hatte es ernst gemeint. Doch den hatte sie vertrieben.
Ihre einzige Chance auf Glück. Vorbei.
Und nun das. Eine zweite Chance.
Ein guter und ehrlicher Mann der sie begehrte. Nicht ihre Hülle. Nicht ihre Haut. Sie selbst.
Er ging mit ihr aus. Er unterhielt sich mit ihr. War interessiert daran, was sie bewegte, was sie fühlte. Nie sah sie Gier in Richards Blick. Nie unbeholfene Unsicherheit ob ihrer Schönheit.
Er sah sie an. Offen und gerade. Fast glaubte sie, er sah, wie sie wirklich war. Welch grauenhaftes Wesen sich hinter der makellosen Fassade in einer dunklen Ecke ihrer Seele zusammenkauerte. Und er wich nicht davor zurück, sondern streckte ihr einfach die Hand entgegen.
Und als er in sie eindrang und sie dabei flüsterte: »Wie kannst du mich lieben? Ich bin ein Monster.«
»Monster sind wir alle.« keuchte er. »Bis wir auf jemanden treffen, der sich freiwillig in unsere Arme begibt … und uns dadurch … befreit.«
Sie hätte lachen müssen. Sie hätte wütend werden müssen. So ein Schwachsinn!
Doch stattdessen liessen seine Worte sie kommen. Die Welle überrollte sie hart und schnell. Und etwas in ihr löste sich wie ein alter Knoten. Wurde locker und frei.
»Mein Gott.« krächzte sie leise. Etwas in ihr zischte noch einmal und trat dann zurück ins Dunkel.
»Schon wieder fleißig?« fragte Katherine. Die Sonne erhob sich gerade über den Pazifik. Rich saß mit seinem Laptop am Pool. Er schien schon seit Stunden auf zu sein. Katherine war aufgewacht, hatte sich eines seiner Hemden übergestreift und ihn gesucht. Sie berührte ihn sanft an der Schulter und küsste ihn dann auf die Schläfe.
»Guten Morgen. Woran arbeitest du?« Sie bereute die Frage sofort. Rich sah gut aus, war gut gebaut und verdammt gut im Bett. Aber er war auch ein Nerd. Er grinste.
»Guten Morgen. Möchtest du das wirklich wissen?«
»Natürlich.« log sie und drückte sanft seine Hand. Er lächelte sie an.
»Nein. Das kann ich nicht verantworten. Du sollst nicht schon nach unserer ersten gemeinsamen Nacht allen Respekt vor mir verlieren.« Katherine lachte.
»In Ordnung. Ich schlage einen Kompromiss vor. Du erzählst es mir beim Frühstück.«
Es gab Rührei mit Speck. Katherine aß ein wenig von dem Ei und dazu ein paar Kiwis mit einem fettarmen Joghurt.
Einmal Supermodel - immer Supermodel.
Nach der zweiten Tasse Cappuccino fühlte sie sich gegenüber Richs Monologen dann gewappnet.
Er konnte stundenlang über Cloud-Dienste, Verschlüsselungstechnologien und vor allem über die Fehler seiner Konkurrenten im Silicon Valley monologisieren. Es war nicht per se langweilig, was er erzählte. Und er gab sich die größte Mühe es allgemein verständlich zu formulieren, aber Katherine verstand dennoch zumeist nur die Hälfte davon.
»Hast du schon einmal von Echelon gehört?«
Katherine schüttelte den Kopf.
»Seit den 90er Jahren betreibt die NSA zusammen mit vergleichbaren Behörden in Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada ein Spionagenetzwerk, um Telefongespräche, Faxverbindungen und Internet-Daten die über Satelliten versandt werden, abzuhören und zu überwachen.«
»NSA?« fragte Katherine.
»Die National Security Agency.«
Katherine runzelte die Stirn, dann schüttelte sie den Kopf.
»Vielleicht hast du mal einen Film mit Will Smith gesehen. ›Der Staatsfeind Nr. 1‹? Da hat er einen Anwalt gespielt, der in die Fänge der NSA gerät.«
Katherine glaubte sich dunkel erinnern zu können. Sie nickte langsam. »Da hat Gene Hackman mitgespielt. Er hat die Wanzen, die Will Smith am Körper trug unschädlich gemacht, in dem er sie in eine Chipstüte gestopft hat.«
»Genau. Das Plastik der Chipstüte ist mit Metall bedampft und wirkt als Faradayscher Käfig.«
»Woher weisst du so etwas?«
Rich zuckte mit den Achseln.
»Und was ist nun mit diesem Echelon?« fragte Katherine.
»Es gibt das Gerücht, dass die NSA jetzt über ein System verfügt, das über Echelon weit hinaus geht.«
»Was für Gerüchte?«
»Nun, seit ein paar Jahren gibt es ungewöhnliche Aktivitäten im Internet. Irgendein System scheint täglich das gesamte Kommunikationsnetz, also Telefon, Internet, Überwachungskameras und Mobilfunknetze zu scannen.«
»Oh-kay.« sagte Katherine. Sie versuchte sich das vorzustellen.
»Dieser Scan erfasste zunächst nur New York, überspannt aber mittlerweile den ganzen Globus.«
»Wie ist das möglich?« fragte Katherine und schenkte Rich ein Glas Orangensaft ein. Rich pflegte sich auch wie ein Nerd zu ernähren. Seine Hauptmahlzeiten bestanden aus Cola und Schokoriegeln. Katherine hatte beschlossen, dies schrittweise zu ändern.
»Ich weiß nicht, wie sie es machen, ich weiß nur das sie es machen.«
»Aber ist das nicht wie … nun, wie die Suche nach einer Stecknadel in einem gigantischem Heuhaufen?«
»Die gespeicherte Datenmenge muss gewaltig sein. Liegt vielleicht schon im Zettabyte-Bereich.«
Rich sah Katherines verwirrten Blick und lächelte.
»Sagen wir einfach dass dieser Informations-Heuhaufen eine kaum vorstellbare Größe besitzt.«
»Aber dann ist das ganze doch kein Problem. Wie will die NSA in einem Heuhaufen kaum vorstellbarer Größe eine Nadel finden?«
»Das ist es, was mich beunruhigt. Die NSA würde so, eine nun … einen so gewaltigem Speicher nicht in Auftrag geben, wenn sie keine Lösung für dieses Problem hätte.«
Rich schwieg und blickte hinaus auf den Pazifik. Katherine wartete bis sie nachhakte.
»Was bedeutet das?«
»Nun, das bedeutet, dass kein Geheimnis auf der Welt mehr sicher ist. Nie mehr.«
»Eine grauenhafte Vorstellung.« murmelte Katherine. Sie dachte an ihr ausschweifendes Leben der letzten Jahre. Viele Episoden davon würde sie gern für immer aus dem kollektivem Gedächtnis des Internets getilgt wissen.
»Es müsste ein Schliessfach für virtuelle Geheimnisse geben. Ein Schliessfach an die selbst diese Maschine der NSA nicht herankommen kann.«
Rich nickte und grinste sie an.
»Peewee und ich haben da eine Idee.« Peewee war Richs Geschäftspartnerin. Sie wirkte ganz sympathisch, doch Katherine hatte den Eindruck, dass Peewee sich durch Katherine auf irgendeine Weise bedroht fühlte. Vielleicht war sie Eifersüchtig? Peewee war angeblich lesbisch, aber auch Katherine hatte schon mit Frauen geschlafen und fühlte sich dennoch mehr zu Männern hingezogen. Und im Moment besonders zu diesem Mann der an einem Orangensaft nippte.
»Was für eine Idee?« fragte Katherine und verscheuchte ihre Gedanken über Peewees Eifersüchteleien.
»Peewee glaubt einen Code entwickelt zu haben, der einen solchen virtuellen Safe vor jedweden Angriffen schützen könnte. Eine universelle Waffe im Kampf gegen virtuelle Drachen wie die NSA. Sie nennt den Code ›Excalibur‹.
»Klingt passend.«
»Ja, ich denke auch. Und ich habe gerade den Namen für die Internetseite unseres virtuellen Schliessfachs schützen lassen.« Er drehte das Laptop so, dass Katherine den Bildschirm lesen konnte.
»Sweepr.net« las sie dort. »Ausputzer?« fragte Katherine.
»So nennt man eine Abwehr Position im Fussball.«
»Nerd.« bemerkte Katherine, stand auf und setzte sich auf Richards Schoß. »Aber das passt zu dir.«, sagte sie und küsste ihn leidenschaftlich.
»Wir landen in Kürze am Institut, Mam.« sagte der Pilot des Hubschraubers über den Kopfhörer.
Katherine war wieder wach und rieb sich die müden Augen. In letzter Zeit verbrachte sie viel zu viel Zeit in der Luft. Sie vermisste ihre Kinder und ihren Ex-Mann Andy.
Und in meinen Träumen vermisse ich immer noch Rich.
Rich und Denny. An ihren toten Sohn Denny dachte sie jeden Tag.
Patricia Russell, die Mutter von Peewee Russell war offenbar aus anderem Holz geschnitzt. Prof. Russell hatte den Umstand, dass ihre Tochter des Terrorismus, des mehrfachen Mordes und des Mordversuchs an einer Staatsanwältin verdächtig wurde und in Folge von Flucht und Verhaftung nun in einem Koma lag, recht gelassen aufgenommen.
»Wie bedauerlich und typisch für das Mädchen.«, hatte sie am Telefon gesagt. Katherine hatte die Professorin angerufen. Offiziell um ihr beizustehen. Inoffiziell um sich in Princeton mit jemanden zu treffen.
Prof. Russell war die erste Frau, der die Leitung des Instituts für angewandte Innovationsforschung übertragen wurde.
Ihr Vater, Prof. Curt Reisfeld, hatte den Posten bereits in den 80er Jahren inne. Nach seinem plötzlichen Tod - einem Autounfall bei dem auch der Mann von Patricia Russell ums Leben kam, wurde ihr der Posten der Direktorin angetragen.
Das Institut war eine Denkfabrik der Regierung. Und wenn etwas Prof. Patricia Russell konnte, dann war es denken. Immerhin war sie eine Reisfeld.
Um unser Ziel, das Institut für angewandte Innovationsforschung, zu erreichen, mussten wir zunächst den Springdale Golfplatz umrunden.
Rechts der Straße lagen niedrige Backsteinhäuser, Links erkannte ich durch enge Baumreihen hindurch ein paar Gestalten die über den gepflegten Rasen schlenderten.
Andy Curkow saß am Steuer. Ich selbst hatte zwar einen Führerschein, aber Andy war eindeutig der bessere Fahrer von uns beiden. »Machen sie sich keine Sorgen.« sagte er. »Inzwischen bin ich daran gewohnt Lisa Arnolds Hintern durch die Staaten zu kutschieren.«, hatte Andy vor dem Antritt der Fahrt gemurmelt.
Die fünfstündige Fahrt von Boston nach Princeton war ruhig verlaufen. Wir hatten in Stanford an einem Diner angehalten, um eine Kleinigkeit zu essen. Während des Mittagessens erzählte mir Andy, wie er mehr oder weniger unfreiwillig in die ganze Geschichte geraten war.
Andy musste sich dabei immer wieder zusammenreißen mich nicht zu intensiv dabei anzustarren. Ich brauchte eine Weile um zu kapieren, dass er sich zu meiner attraktiven Erscheinung hingezogen fühlte. Nun, ich konnte es ihm nicht verübeln. Ich fühlte mich selbst zu meiner Erscheinung hingezogen. Auch die Männer im Diner, wo wir unser Mittagessen einnahmen warfen mir bewundernde Blicke zu.
Ich war es nicht gewohnt soviel Aufmerksamkeit für mein Aussehen zu erhalten. Aber das war ja im Grunde auch nicht der Fall. Der Körper in dem ich steckte gehörte immer noch Lisa Arnold, nicht mir.
»Was ist?«, fragte Andy, der mir in der Nische gegenüber saß. Ich grinste.
»Sie starren mich wieder an, Andy.« Andy lief rot.
»Entschuldigen sie.« Beschämt starrte er auf seinen Teller und schwieg eine Weile.
»Es ist nicht so, wie sie denken.«, sagte er dann, ohne aufzusehen. »Ich starre sie nicht an, weil der Körper in dem sie stecken so ausnehmend attraktiv ist.« Er seufzte, rieb sich das Gesicht mit den Händen und schaute sie schließlich wieder an. »Ich starre sie an, weil ich gesehen habe, was Mütterchen mit diesem Körper angestellt hat … und ich nichts dagegen unternommen habe, sondern davon gerannt bin.«
Ich tätschelte Andy sanft die Hand. »Hey, schon okay.« Andy grinste unbeholfen. »Nein. Es ist nicht okay. Aber ich werde damit Leben müssen.«
»Ich wäre wahrscheinlich auf weggelaufen, Andy.« sagte ich. Andy schüttelte den Kopf.
»Nein, das glaube ich nicht, Miss Russell. Sie sind zäher, als sie es sich selbst eingestehen wollen.«
Ich bemerkte, wie ich von verschiedenen Männeraugen im Diner taxiert wurde. Ich seufzte.
»Alles in Ordnung?« fragte Andy. Ich nahm mein Glas mit Eiswasser, trank es halb leer und rülpste. Sehr laut und äußerst undamenhaft. Peinlich berührt sahen die meisten meiner stummen Verehrer, einige lachten dabei. Ich grinste Andy an.
»Jetzt schon.« Ich stand auf. »Kommen sie, fahren wir weiter.«
Einige Stunden und etwa einhundert Meilen später waren wir am Ziel. Wir fuhren die Olden Lane entlang. Das Gelände des Instituts lag rechts von uns und war von hochgewachsen Hecken umzäunt. Dann bog Andy mit dem Wagen in die Einstein Lane. Zwischen einer Gruppe von Bäumen erkannte ich in der Ferne schon das Hauptgebäude.
Plötzlich hörte man das Knattern eines sich Hubschraubers. Er näherte sich dem Institut vom Norden her. Er kreiste einmal und setzte dann auf einem der betonierten Parkplätze des Instituts zur Landung an. Die Bäume vor uns schüttelten sich im Wind der Rotoren.
»Das muss Katherine Williams sein.« murmelte Andy.
»Yep.«, stimmte ich zu.
Ich hatte Andy gedrängt sich bei Katherine Williams zu melden.
Er räusperte sich, als er in den Hörer des öffentlichen Münztelefons vor dem Diner sprach.
»Hallo, Miss Williams. Hier spricht Andy Curkow. Ja… Ja, ich lebe noch.« Eine Pause. »Ja. Lisa auch.«
Ich hatte Andy während der Fahrt erklärt, dass ich es für besser hielt, Katherine Williams nicht von ›Mütterchens‹ kleinem ›Gehirn wechsle dich‹ Spielchen zu erzählen. Der Grund war ganz einfach. Ich traute Katherine Williams nur so weit, wie ich sie werfen konnte. Immerhin hatte sie mich auf dem Rollfeld in San Francisco in die Falle von Samantha Risk tappen lassen.
Andy war zwar anderer Meinung, wollte aber das Spiel mitspielen. Er sah mich an und nickte.
»Ja, sie steht neben mir.« Wieder ein Pause. »Ich denke, das sollte sie ihnen lieber selbst sagen.
Andy reichte mir den Telefonhörer.
»Sie will mit ihnen sprechen.« Nun war es an mir, mich zu räuspern.
»Hi.« sagte ich knapp.
»Lisa! Gott sei Dank! Was ist in Maiden passiert?« fragte die Williams. »Lange Geschichte.« antwortete ich. »Zu lang, um sie jetzt am Telefon zu erzählen. Kommen sie nach Princeton. Da können wir reden.«
Ich fühlte mich ein wenig unbehaglich meine Mutter in die ganze Sache reinzuziehen, aber ich brauchte dringend ihren Rat. Und wenn Katherine Williams anbiss, bekam ich als Bonus doch noch zu meiner Audienz bei der ›Göttin‹. Am anderen Ende der Leitung überlegte Katherine kurz. Dann sagte sie: »In Ordnung. Ich komme.«
»Okay. Bis dann.« Ich legte auf.
Andy und ich parkten den Wagen auf einem der Parkplätze vor dem Hauptgebäude. Er begutachtete den hübschen Bau aus Backstein.
»Nette Irrenanstalt.« sagte er. Ich grinste. »Glauben sie mir, Andy. Dieses Institut ist eine Irrenanstalt. Spätestens seit meine Mutter die Leitung übernommen hat.« Ich wollte aussteigen, doch Andy hielt mich mit einer Berührung am Arm zurück. Er sah mich an und deutete mit einem Kopfnicken auf den Parkplatz wo eben der Hubschrauber mit Katherine Williams gelandet war.
»Es klingt vielleicht seltsam von jemanden, den diese Frau entführen ließ. Aber ich habe immer noch ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken Katherine Williams etwas vorzumachen.« Ich seufzte.
»Das haben wir doch schon stundenlang durchgekaut. Ich bin davon überzeugt, dass die Williams nicht die ganze Wahrheit über die Hintergründe von ›Mütterchen‹ erzählt hat. Ich weiß noch nicht wie ich das beweisen soll und ob und wie wir ›Mütterchen‹ unschädlich machen können.« Ich zögerte. Auch Andy wollte ich noch nicht mein vollständiges Blatt zeigen. »Aber vielleicht kann da meine Mutter uns weiterhelfen.«
»Wie?« fragte Andy. Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß es noch nicht genau.«, log ich. Andy seufzte. »Na, schön. Bringen wir es hinter uns.« Er stieg aus, öffnete die hintere Tür, griff sich seinen Fedora und setzte ihn auf. Gemeinsam traten wir die Stufen zum Eingang hinauf.
Die Tür öffnete sich. Zwei Sicherheitsbeamte in dunklen Anzügen versperrten uns den Weg.
»Tut uns leid. Vertreten verboten.« sagte einer der beiden Männer höflich, aber bestimmt.
»Wir sind hier um mit Professor Russell zu sprechen.« erklärte ich. » Sie erwartet uns.« Das war natürlich gelogen. Weder Andy noch ich in meiner Erscheinung als Lisa Arnold waren würdig genug von meiner Mutter empfangen zu werden.
»Tut uns leid. Keine Termine. Keine Besuche.« sagte nun der andere Mann. Beide machten sich ein wenig breiter. Andy nickte den beiden höflich zu und trat zurück. Ich zögerte, dann trat ich ebenfalls zurück.
»Sicher nur ein Missverständnis.« erklärte ich. Wir gehören zu Katherine Williams.« Ich deutete auf die hochgewachsene Frau die vom Parkplatz herüber schlenderte. »Da kommt sie.«
Katherine Williams nickte Andy und mir zu. »Guten Tag, meine Herren. Mein Name ist Katherine Williams. Diese Beiden gehören in der Tat zu mir. Wir haben eine Verabredung mit Professor Russell.« Einer der Männer öffnete den Mund, um zu antworten, als sich plötzlich beide in einem Sekundenbruchteil ihre Waffen aus den Brustholstern zogen.
Katherine Williams Lippen wurden schmal. Andy und ich hoben automatisch unsere Hände. Ich bemerkte zuerst, dass die Männer nicht wegen uns die Waffen gezogen hatten, sonder wegen etwas, was sich hinter uns befand. Ich hörte ein elektrisches Surren und drehte mich zu dem Geräusch um.
Es waren kleine, ferngesteuerte Autos. Sie kamen zu Dutzenden die Einfahrt hinauf. Sie waren schwarz und jedes von ihnen war etwa so groß wie ein Schuhkarton. Sie fuhren auf hohen, metallenen Speichenrädern. Die Räder waren angewinkelt und wirkten so wie die angelegten Flügel eines Vogels.
Es dauerte einen Moment, bis mein Verstand diese Bauweise mit einer möglichen Funktion verknüpfte.
»Scheiße.« entfuhr es mir.
Die Räder der kleinen Fahrzeuge zogen sich zusammen. Dann entliessen sie die so entstandene Spannung und sprangen wie Grashüpfer in die Höhe. Gleichzeitig klappten die Räder aus der Vertikalen in die Horizontale und ihre Speichen begannen rasend schnell zu rotieren. Mit einem metallenem Klicken entledigten sie sich dann noch ihrer Bereifung.
So waren aus hunderten von kleinen Fahrzeugen nun hunderte von kleinen, wütend vor uns schwebende Quadrocopter geworden.
»Ich hasse es, immer recht zu haben.« murmelte ich. Die beiden Männer mit den gezogenen Waffen eröffneten das Feuer. Die Schüsse trafen ein paar der Copter, die in einem Funkenregen zu Boden gingen.
Daraufhin wandte sich der Drohnen-Schwarm synchron den Männern zu. Wie bei einem Nagelbrett formte sich aus dem Schwarm das Gesicht einer Frau.
Es war das Gesicht von Audrey.
Einer der Männer feuerte weiter. Er zielte auf die ›Augen‹ des ›Gesichts‹. Einige Copter fielen zu Boden doch schon nahmen andere ihren Platz ein. Das ›Gesicht‹ grinste. Dann ›fraß‹ das ›Gesicht‹ einen der Männer. Sein Körper verwand in einem Wirbelwind von Drohnen, die ihm bei lebendigen Leibe Kleidung und Haut vom Körper schälten. Der Mann ging zu Boden. Der Schwarm ließ von ihm ab. Zurück blieb ein blutiges Skelett umkränzt von einer Corona aus Stofffetzen, Fleisch, Muskeln und Blut.
Erst angesichts dieses Grauens begriff ich, was Andy so traumatisiert hatte, als die Drohnen in Maiden über Lisa Arnold hergefallen waren.
Für den anderen Mann war dieser Anblick auch zuviel. Er verlor die Nerven, ließ seine Waffe fallen und rannte in Richtung des Parkplatzes, wo der Hubschrauber von Katherine Williams stand.
Das ›Gesicht‹ schüttelte traurig den Kopf, holte ihn mühelos ein und verschluckte dann auch ihn.
Der Mann gab ein hohen, quiekenden Schrei von sich, als er starb. Dann war auch er nur noch ein blutiges Skelett, dass zu Boden fiel.
Der Schwarm formierte sich wieder zu Audrey Gesicht und wandte sich nun uns zu. Die Rotoren variierten ihre Umdrehungsgeschwindigkeit. Aus dem unterschiedlichen Surren formte sich eine Stimme, die Audreys ›Gesicht‹ lippensynchron aussprach.
»Guten Tag. Hallo Katherine. Hallo Andy.« Audrey machte eine Pause. »Hallo Peewee. Gefällt dir dein neuer Körper?«
»Die Titten sind okay.« knurrte ich sie an. Audrey grinste. »Es freut mich, dass sie dir gefallen. Du konntest dich länger im Spiel halten, als vermutet. Ich möchte meinen Dank für deine treuen Dienste aussprechen. Du hast dafür gesorgt, dass alle Individuen, die meinen Plänen noch gefährlich werden können, nun an diesem Ort versammelt sind. Vielen Dank. Ende der Kommunikation.«
Das Surren der Rotoren wurde wieder synchron.
Hinter mir hörte ich, wie sich die Eingangstür öffnete. Der Drohnen-Schwarm kam näher auf uns zu. Das Surren wurde lauter. Ich schloss die Augen.
Hoffentlich hatte ich auf die richtige Variable gesetzt.
»GENUG!« rief eine laute, mir nur zu vertraute Stimme hinter mir.
Ich drehte mich um und öffnete halb ein Auge.
Meine Mutter stand da. Sie sah von uns zu den beiden Leichen der Wachmänner zu Audrey.
»DU!« donnerte Audreys surrende Stimme.
»Schäm dich!« sagte meine Mutter und hob ihre rechte Hand. Darin hielt sie eine kleine Fernbedienung. Audreys Augen weiteten sich vor Schreck. Sie fuhr zurück, doch es war zu spät. Meine Mutter betätigte eine Taste auf der Fernbedienung.
Ein bläuliches Licht entwich mit einem tiefen Basston der Fernbedienung und breitete sich Fächerförmig aus. Dort, wo das blaue Licht auf eine Drohne traf, fiel sie zu Boden. Wellenförmig fiel der Schwarm der Drohnen zu Boden.
Meine Mutter starrte auf das Trümmerfeld der nun ausser Gefecht gesetzten Drohnen und senkte dann langsam den Arm mit der Fernbedienung. Dann sah sie mich an.
»Hallo, junge Dame. Sie sehen nicht aus wie meine Tochter, aber dieses Ding hat sie bei ihrem Namen genannt. Zufall?«
»Nein, Mutter.« sagte ich. »›Mütterchen‹ hat mich in ihren Körper gesteckt.« Meine Mutter nickte »Ich verstehe.« Sie wandte sich an Andy und Katherine Williams. »Gehen wir lieber hinein. Nach diesem EMP-Burst braucht der Reaktor im Keller wieder ein paar Minuten um den Schutzschirm wieder aufzubauen.« Sie warf einen Blick auf die Leichen der Wachmänner und schüttelte traurig den Kopf. »Was für ein Schlamassel. Ich lasse uns nach dieser Aufregung am Besten gleich einmal Tee servieren.«
Rachel Garrett und Phil führten Lisa in die Höhle. Am Eingang nahm Rachel eine Fackel von der Wand. Sie brannte in demselben grünlichem digitalen Feuer, wie die Lagerfeuer am Strand. Lisa spähte in das Dunkel.
»Was ist das hier?« fragte Lisa.
»Die Höhle der Schläfer.« erklärte Rachel und ging weiter. Lisa blieb unschlüssig. Phil bedeutete ihr, ihnen zu folgen. »Come With Me.«
Zögernd folgte Lisa den beiden Frauen tiefer in die Höhle hinein.
Nach einem etwa zwanzig minütigem Fußmarsch erweiterte sich die Höhle zu einer steinernen, unterirdischen Halle. Aus Quadern geformte Stalaktiten hingen von der Decke herab. Ihre stumpfen Spitzen glühten in fluoreszierendem Grün. Lisa blickte nach unten und starrte in einen bodenlosen schwarzen Trichter. Eine schmaler, offener Treppengang am Rand des Trichters führte spiralförmig den dunklen Schlund hinab. Die Stufen waren grob in den Fels gehauen worden.
»Bitte Vorsicht.« sagte Rachel. »Der Gang ist schmal und der Weg nach unten ist sehr, sehr weit.«
»Müssen wir denn da hinunter?« Rachel nickte. »Wir müssen.«
»Warum?«
»Die Antworten auf all deine Fragen findest du dort unten.«
Lisa seufzte und folgen den beiden Frauen die Stufen hinab. Nach etwa zehn Minuten kamen ihnen auf dem Treppengang ein paar Gestalten entgegen. Sie trugen dieselben grauen Gewändern wie Rachel Garrett. Sie beachteten die drei Frauen nicht, sondern schoben sich teilnahmslos an ihnen vorbei. Eine der Gestalten stolperte. Es war eine ältere Frau. Ihr Körper war ausgemergelt, ihr Haar schlohweiß. Sie schwankte kurz, dann stürzte sie lautlos hinab in den Abgrund.
Lisa schrie auf und wollte die Gestalt noch packen, doch ihr Griff ging ins Leere. Dabei verlor Lisa fasst selbst das Gleichgewicht. Phil packte sie beherzt am Kragen und zog sie zurück.
Die anderen Gestalten hatten sich nicht einmal umgedreht und waren weiter geschlurft.
»Against All Odds« brummte Phil. Lisa tätschelte der Riesin dankbar den Arm. »Ich weiß, Phil. Das war knapp.« Lisa spähte vorsichtig über den Rand und biss sich nachdenklich auf die Lippen. Sie hatte sich verschätzt. Hätte sie in ihrem eigenem Körper gesteckt, hätte sie vielleicht die Frau retten können. Rachel berührte sie sanft an der Hand. »Es ist nicht schlimm. Die Frau wird einfach ein weiteres Mal von Mütterchen erweckt werden müssen.«
Lisa erstarrte. »›Mütterchen?‹ Dort unten wartet das ›Mütterchen‹?!« Rachel lächelte. Peewee hätte das Lächeln erkannt. Es war das geduldige Lächeln einer Grundschullehrerin. »Keine Sorge, Lisa Arnold.«
»Keine Sorge?!« rief Lisa. »Wegen diesem Miststück stecke ich in diesem dürren kleinen Körper!«
Rachels Lächeln gefror. »Mich hat ›Mütterchen‹ qualvoll ermordet. Dennoch habe ich ihr verziehen.«
»Verzeihen? Ich soll dieser Schlampe verzeihen?!«
»That's Just The Way It Is.« pflichtete Phil Rachel bei. Lisa schüttelte ungläubig den Kopf. »Aber Phil … Weisst du denn nicht mehr, was sie uns angetan hat?« Phil nickte langsam. Dann deutete sie stumm die Stufen in die Dunkelheit hinab.
Rachel ergriff sanft Lisas Arm. Lisa entzog sich ihrem Griff. Rachel hob abwehrend die Hände. »In Ordnung. Du musst nicht mit uns kommen.« Sie seufzte. »Oben, vor der Höhle habe ich dir gesagt, dass dies die wirkliche Welt ist.« Lisa sagte nichts. Rachel fuhr fort. »Nun, dies hier ist, wie ich schon sagte, die Höhle der Schläfer. Aber dies ist auch die Welt der Lügen. Du musst diese Welt sehen, damit du verstehst, was die Wahrheit ist.«
Phil nickte zustimmend. Rachel deutete auf die große Frau. »Auch wenn du mir nicht vertraust. Glaubst du wirklich Phil würde dir Schaden wollen, Lisa Arnold?«
Lisa sah von Rachel zu Phil und dann wieder zu Rachel. Langsam schüttelte sie den Kopf. »Nein, das würde sie nie tun.«
»Also dann, komm mit uns.« Sie hob wieder die Fackel und ging voran. Phil folgte ihr. Widerstrebend schloss sich Lisa an. Gemeinsam stiegen sie tiefer in den dunklen Schlund hinab.
Meine Mutter sah älter und müder aus, als ich sie das letzte Mal gesehen hatte.
Das war am Ende meines Gerichtsverfahrens wegen tätlichen Angriffs gewesen. Ich hatte gerade verloren. Reporter auf den Stufen des Gerichts hatten mich gejagt. Mein Verteidiger hatte mich aus dem Pulk der Journalisten zu einer Limousine mit dunklen Scheiben geführt. Eine der Scheiben senkte sich und dahinter erschien das Gesicht meiner Mutter.
»Du hast verloren.« sagte sie zu mir. Kein ›Hallo‹ oder ›Mein Liebling, geht es dir gut‹. So war Mutter nicht.
»Ja.« antwortete ich daher nur.
»Brauchst du meine Hilfe?« fragte sie.
Ja. Ja, ich brauche dich. Ich habe dich mein ganze Leben gebraucht, aber du warst nie für mich da! Mein Augen füllten sich mit Tränen. Ich schluckte sie herunter. Meine Mutter hasste Selbstmitleid. Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Ich komme schon klar.«
»Gut.« sagte meine Mutter. Die Scheibe hob sich wieder. Ich sah noch wie sie dem Fahrer bedeutete, loszufahren.
Kein Verabschiedung. Keine Berührung.
Ist meine Mutter nicht ein Herzchen?
Mutter servierte uns Johanniskrauttee in der kleinen Bibliothek im ersten Stock des Instituts.
Auf die Frage von Katherine Williams nach einem Kaffee rollte meine Muttern nur mit den Augen.
»Was die Genetik ihnen an Aussehen geschenkt hat, hat ihnen ihre Sozialisation an Kultur wieder genommen, meine Liebe.« Sie reichte Katherine Williams eine Tasse Tee. Katherine nahm sie, ging damit ans Fenster und starrte nachdenklich hinaus. Sie nippte vorsichtig an dem heißen Getränk und verzog das Gesicht.
»Wirklich kultiviert, so eine Teestunde im Angesicht von ein paar Leichen in der Einfahrt.« sagte sie und stellte ihre Tasse auf dem Schreibtisch meiner Mutter auf einen Stapel Papieren ab.
Tun sie das lieber nicht, dachte ich. Meine Mutter hatte ein ausgeprägtes Revierverhalten.
»Reflexion ist im Angesicht der Krise die beste Waffe, Miss Williams.« sagte sie, nahm die Tasse der Williams und stellte vorsichtig beiseite.
»Ich hätte mich nie auf ihre Expertise verlassen sollen, Professor Russell.« sagte Katherine Williams, verschränkte die Arme und starrte wieder zum Fenster hinaus.
»Haben sie aber.« erwiderte meine Mutter kühl. »Und nun muss die Welt aus den von uns begangenen Fehlern lernen.«
»Was hast du getan, Mutter?« fragte ich.
Meine Mutter wandte sich mir zu.
»Was ich immer tue, P. Was mir dein Vater beigebracht hat.« Sie machte eine Pause.
»Niemals aufgeben.«
Vor dreiundzwanzig Jahren, in einer anderen Welt …
»Sind wir bald da?« fragte die kleine Peewee und starrte gähnend aus dem Bullauge neben ihrem Platz des Aries II Raumtransporters. Sie hatten auf der Raumstation V kurz halt gemacht, bis der Raumtransporter bereit stand der sie nun zum Mond transportierte. Peewee war mit ihren drei Jahren ein Beispiel der sogenannten Tech Natives. Für ihre Generation war es selbstverständlich zum Mond zu reisen, um ihren Vater zu besuchen. Die kleine Peewee hatte immer noch leichtes Fieber. Die letzten Tage hatte sie mit einer Bronchitis im Bett gelegen.
Nun folgten Mutter und Kind endlich dem Vater zum Mond. Zum Mond!
Patricia Russell dachte oft daran was aus der Welt geworden wäre, wenn das Rennen um die Sterne nach der Beendigung des kalten Krieges nicht fortgesetzt worden wäre. Die Konflikte in Vietnam, Afghanistan und später in Jugoslawien wurden zum Glück friedlich beigelegt. Für alle Industrienationen waren die Bodenschätze auf dem Mond lukrativer als der Kampf um politischen Einfluss oder fossile Brennstoffe auf der Erde. Dank einiger Formeln auf einem metallenen Streifen Papier spielten sie keine große Rolle mehr.
Als Kind hatte sie zusammen mit ihrem jetzigem Mann ein Abenteuerreise zu den Sternen unternommen. Und wie bei jeder Heldenreise kehrten sie auch in dieser mit einem Glück verheißendem Elixier zurück. Die Formeln auf dem Metallpapier ermöglichten es billige, saubere Energie zu erzeugen.
Die Spinner Pons und Fleischmann hatten Recht gehabt. Kalte Fusion war möglich. Mit Hilfe der Formeln auf dem Metall-Papier wurde der Menschheit aufgezeigt wie dies zu bewerkstelligen war.
Ebenso sollte es nun möglich sein eine Kernreaktion aus der Ferne zum Stillstand zu bringen. Dies war eine Technik die den zahlreichen Atommächten auf der Erde zwar nicht schmecken würde. Doch der Föderation Freier Nationen würde es ihre Aufgabe der weltweiten Friedenssicherung wesentlich einfacher machen. Eine geheime Versuchsanlage für dieses Experiment wurde unter der technischen Leitung von Patricias Mann, Clifford östlich der Tombaughstation errichtet. Heute würde der Versuchsreaktor in Betrieb genommen werden.
Der Bildschirm der in die Rückenlehne des Sitzes vor Peewee eingebaut war, erwachte zum Leben. Eine lustige Manga Figur erschien darauf.
»Liebe Peewee, wir erreichen den Mond in exakt 38 Minuten!« erklärte die Manga Figur und beantwortete die von Peewee zuvor gestellte Frage.
Peewee schob trotzig die Unterlippe vor.
»Hab nicht dich gefragt.« grummelte sie. Trish lachte und gab ihrer Tochter einen Kuss.
»Bald ist es geschafft, P.«
Nun aktivierte sich der Bildschirm vor ihrem Sitz.
Ein ›Facetime‹ Anruf kam herein. Trish nahm den Anruf entgegen. Das Gesicht ihres Mannes erschien auf dem Schirm. Clifford wirkte müde und besorgt.
»Hey, Liebling. Wo seid ihr?«
»Clifford! Wir sind auf dem Weg zum Mond. Was ist los?«
»Daddy!« rief Peewee.
»Hallo Kleines.« sagte er gespielt fröhlich. Er rieb sich seine Bartstoppeln und wandte sich dann wieder seiner Frau zu. »Hör zu, Trish. Ich möchte, dass ihr sofort umkehrt. Wir haben hier ein paar Probleme mit dem Reaktor.«
»Was für Probleme?« fragte Patricia. Doch ihr Mann beachtete sie nicht. Etwas ausserhalb des Bildausschnitts nahm seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Sein Gesicht wurde aschfahl. Angsterfüllt schrie er in die Kamera: »Kehrt um! Es ist ausser Kontrolle! Kehrt …« Dann wurde die Verbindung unterbrochen.
»Daddy?« fragte Peewee unsicher.
Ein heller Blitz erhellte das Bullauge. Patricia hob die Hände. Sie konnte die Knochen unter der Haut erkennen.
»Oh, Gott.« dachte sie noch.
Dann dachte sie nichts mehr.
Vor dreiundzwanzig Jahren, in dieser Welt …
»Sind wir bald da?« fragte die kleine Peewee und starrte gähnend aus dem Fenster neben ihrem Platz der United Airlines Linienmaschine.
Trishs Mund entwich ein leiser Schrei.
»Mommy? Was ist, Mommy?«
Sie starrte ihr Kind an. Es saß da, wie eben noch. Doch sie saßen nicht mehr im Raumtransporter.
Was zum Teufel ist hier los?
»Ladies und Gentleman, in Kürze erreichen wir den Dulles International Airport …« sprach die sanfte Stimme der Flugbegleiterin über die Bordsprechanlage.
Washington? Warum fliegen wir nach Washington?
»Mommy?« fragte das Kind, das auf dem Platz ihrer Tochter saß. Sie sah aus wie ihre Tochter. Doch sie war es nicht. Ihre Tochter war tot. Ebenso wie ihr Mann und ihr Vater. Und wie wahrscheinlich alle Menschen auf dem Mond.
»Mom …« begann sie.
Nicht mein Kind. Nicht meine Welt. Und nicht mein Kind!
»Mir ist nicht gut.« sagte sie zu dem Kind. Hastig schnallte sie sich ab und torkelte zum Waschraum. Die Flugbegleiterin wollte sie aufhalten.
»Mam? Bitte, wir landen in Kürze!«
»Nur einen Moment. Mir ist übel.« sagte Trish, schob sich an der Frau vorbei in den Waschraum, schloss die Tür und verriegelte sie.
Die Flugbegleiterin klopfte höflich, aber bestimmt an die Tür.
»Mam, bitte beeilen sie sich. Es ist nicht gestattet sich während des Landevorgangs in den Waschräumen aufzuhalten.
»Besetzt!« bellte Trish hinaus. Sie öffnete den Wasserhahn und wusch sich fahrig das Gesicht.
Sie betrachtete ihr Abbild im Spiegel. Sie sah aus wie sie selbst. Doch es gab ein paar kleine Veränderungen. Fältchen an anderen Stellen. Ihre Haare waren anders geschnitten und gefärbt.
»Besetzt« krächzte sie leise. Sie war irgendwie in dieses Zerrbild ihrer Realität geraten. Sie steckte im Körper von einer alternativen Version von Patricia Russell. Irgendwie hatte sie den Platz dieser Frau in dieser alternativen Welt eingenommen. Ihn besetzt wie bei einer Umwandlung beim Schach.
»Mam!« rief die Flugbegleiterin. Ihr Klopfen wurde nun lauter. »Ihre Tochter ruft nach ihnen.«
Trish atmete tief ein und atmete seufzend aus. Dann öffnete sie die Tür.
»Sie ist nicht mein Tochter.« sagte sie zu der Flugbegleiterin. »Meine Tochter ist tot.« Die Frau starrte sie verwirrt an. Trish schüttelte müde den Kopf. »Vergessen sie’s. Danke, ich kümmere mich um sie.«
Als Trish mit ›ihrem‹ fremden Kind auf dem Arm durch die Türen der Ankunftshalle schritt, wurde sie von einem schwarzen Paar in Empfang genommen.
Die Frau trug ein dunkles Kostüm und eine Hochsteckfrisur. Der Mann war ein Riese trug einen dunklen Anzug und hatte einen kahl rasierten Schädel der im Licht Deckenbeleuchtung glänzte wie polierter Granitstein.
»Doktor Russell?« sprach die Frau Trish an.
Trish nickte. Die Frau streckte ihr die Hand entgegen. »Ashera Arnold, Ich leite die Abteilung ›Spezielle Projekte‹ des Verteidigungsministeriums. Ihr Mann arbeitet für mich, Doktor Russell.«
»Verstehe.« log Trish.
»Ich vermute, sie fragen sich, warum ihr Mann sie nicht vom Flughafen abholt.« sagte Ashera und blickte dabei betreten zu Boden.
Nein. Nicht auch hier, dachte sie.
»Ehrlich gesagt ja, Miss Arnold. Das Frage ich mich wirklich. Ist etwas passiert? Ist irgendetwas mit Clifford?« fragte sie.
»Wo ist Daddy?« fragte Peewee verschlafen auf ihrem Arm. Ashera Arnold lächelte das Mädchen an und entblößte dabei eine Reihe makellos weißer Zähne. »Ich muss mich kurz mit deiner Mutter unterhalten, Peewee. Wie wäre es, wenn du und Mr. Johnson dort hinüber ins Café gehen und er dir ein großen Becher Eis bestellt? Was hältst du davon?«
Peewees Augen wurden groß. »Klingt super!« sagte sie. Sie sah Trish fragend an. »Darf ich, Mum?«
Trish nickte, ließ sie herunter und sah, wie Peewee an der Hand des riesigen Mannes in Richtung Café schlenderte.
»Was für Eis magst du am liebsten?« fragte Mr. Johnson Peewee beim weggehen.
»Schokolade!« jauchzte Peewee.
»Hab ich es mir doch gedacht.« sagte Mr. Johnson.
Als die beiden ausser Hörweite waren, wandte sich Trish wieder Ashera Arnold zu.
»Clifford ist tot, nicht wahr?« Ashera Arnold nickte.
»Es hat einen Unfall in einem unserer Labors gegeben.«
»Hat er gelitten?«
»Ich kann ihnen leider nicht mehr dazu sagen. Das ist Verschlusssache. Nationale Sicherheit, sie verstehen?«
»HAT ER GELITTEN?« schrie Trish Ashera Arnold an.
Einige Passanten drehten sich zu den beiden Frauen um. Ashera Arnold seufzte.
»Ich mache mich bereits strafbar, dass ich mit ihnen darüber spreche, Doktor Russell. Offiziell ist ihr Ehemann bei einem Autounfall ums Leben gekommen.«
Trish ergriff die Hände der Frau.
»Hat … er … gelitten?« fragte Trish erneut. Das Gesicht von Ashera Arnold wurde hart. Sie sah Trish direkt in die Augen.
»Ja. Das hat er. Es war ein sehr qualvoller Tod.« Sie schluckte. »Hören sie. Trotz der Regularien. Ich hielt es für meine Pflicht ihnen persönlich mitzuteilen, was passiert ist.« Sie warf ein Blick in Richtung des Cafés. Man hörte das vergnügte Quietschen von Peewee, als sie sich auf den Eisbecher stürzte.
»Ich habe selbst eine Tochter. Sie ist etwa in Patricias Alter.«
»Sie mag nicht so genannt werden.« sagte Trish. »Ich nenne sie immer P.«
»Okay.« sagte Ashera Arnold und nickte langsam. »Ich werde Mr. Jonson bitten sie zum Apartment ihres Mannes zu fahren.«
»Danke.« murmelte Trish abwesend.
Zum Abschied drückte Ashera Arnold noch einmal kurz die Hand von Trish.
»Es tut mir leid.« sagte sie, und ging.
Trish blieb allein, in einer ihr fremden Welt, zurück.
In der Gegenwart, in dieser Welt …
»Was hast du getan, Mutter?« fragte ich sie.
Meine Mutter hielt inne. Einen Moment lang wurde ihr Blick leer. Sie schien Welten entfernt. Füllten sich ihre Augen vielleicht mit Tränen? Nein. Patricia Russell weinte nicht. Sie blinzelte einmal und der Augenblick war vorüber.
Sie wandte sich mir zu.
»Was ich immer tue, P.. Was mir dein Vater beigebracht hat.« Sie machte eine Pause.
»Niemals aufgeben.«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage, Mutter!«
Katherine Williams seufzte. »Sagen sie es ihr, Professor.« Nun seufzte meine Mutter.
»Na, schön.« sagte meine Mutter. »Holen wir die Leichen aus dem Keller.«
Meine Mutter bat uns, um den Kamin Platz zu nehmen. Katherine und ich setzten uns. Andy blieb stehen.
»Mr. Curkow?« fragte meine Mutter ihn.
»Ich bleibe lieber stehen, Ma’am.« sagte er und studierte die Rücken der Bücher in dem Regal vor ihm. Meine Mutter zuckte mit den Achseln.
»Wie sie meinen.«
»Also …« begann ich. »Über welche Leichen in deinem Keller möchtest du mit uns sprechen, Mutter?«
Meine Mutter und Katherine Williams tauschten Blicke. Katherine sah weg. Meine Mutter seufzte.
»Gott, das ist so demütigend.«
»Mum?« fragte ich nach. Sie seufzte erneut und begann dann stockend zu erzählen.
»Als dein Vater überraschend starb, war ich vollkommen am Boden zerstört. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr, aber ich stürzte in eine tiefe Depression.«
»Natürlich erinnere ich mich.« sagte ich.
Meine Mutter lachte auf. Es war ein trauriges Lachen. »Ja, du warst schon früh ein aufgewecktes Kind.«
»Erzähl weiter.« Meine Mutter fuhr fort.
»Eine zeitlang verfiel ich dem Wahn, dass ich irgendwie in diese Welt ›gereist‹ war. Eine Welt, die parallel zu meiner eigenen existierte. Ich hatte das Gefühl nicht in diese Welt zu gehören. Ich begann davon zu faseln, dass ich als ein junges Mädchen zusammen mit deinem Vater die Erde vor einer außerirdischen Invasion bewahrt hatte.« Sie hielt die Hände in die Höhe. »Kurz gesagt, ich hatte den Verstand verloren.«
Ich rollte mit den Augen. »Komm langsam zum Punkt, Mum!«
»Ich besaß zumindest soviel Verstand mich selbst in eine Nervenheilanstalt einzuweisen und zu veranlassen, dass du zu Pflegeeltern kamst. In der Anstalt ging es mir bald besser. Eines Tages bekam ich dann Besuch von einer Frau vom Verteidigungsministeriums. Ihr Name war Ashera Arnold.«
Etwas fiel mit einem satten ›WHUMP‹ zu Boden. Wir drehten die Köpfe. Andy war ein Buch aus den Händen gefallen.
»Entschuldigung.« sagte er kleinlaut. Meine Mutter schnalzte mit der Zunge, bevor sie fortfuhr.
»Ashera Arnold war es, die mich damals über … über den Tod deines Vater informiert hatte. Es tat ihr Leid, dass es mir so schlecht ging. Sie glaubte nicht, dass ich verrückt sei. Sie war der Überzeugung, dass mein Geist wirklich aus einer anderen Welt in diesen Körper übertragen worden war. Sie bot mir Hilfe an dieses Leben in dieser Welt akzeptieren zu lernen. Als Gegenleistung sollte ich sie bei einem Forschungsprojekt mit Namen ›Charon‹ unterstützen.
»Guter Gott!« rief Andy Curkow aus. Wieder drehten wir die Köpfe. Wieder murmelte er eine Entschuldigung.
»Zunächst dachte ich, sie wollte an mir Experimente durchführen und ich lehnte ab. Doch meine einzige Aufgabe war es, ihr von dieser alternativen Welt zu berichten. Welche Technologien wurde dort eingesetzt, welche Fortschritte hatte man dort mit diesen Technologien gemacht. Insbesondere auf dem Feld der Informationstechnolgie.«
»Wozu?« fragte ich
»Bei dem Projekt ›Charon‹ handelte es sich um den Versuch den menschlichen Geist in eine Maschine zu übertragen. Die Anwendungsmöglichkeiten einer solchen Maschinenintelligenz wären natürlich endlos.«
Ich blies die Luft aus. Unglaublich. Das war alles nicht zu fassen.
»Doch neben großen Chancen sah ich auch große Gefahren. Ich stieg aus dem Projekt aus. Vor zwei Jahren wurde Ashera Arnold dann verhaftet und zu mehrfacher lebenslanger Haft verurteilt. Neben dem Projekt ›Charon‹ hatte sie noch weitere Projekte initiiert. Darunter das Projekt ›Lazarus‹, welches das Monster Parker Daley erschuf, das von Katherine Williams besessen war, mehrere Menschen ermordete und schließlich versuchte Katherine selbst zu töten.«
Natürlich kannte ich die Geschichte. Ich wusste nur nicht, das meine Mutter Ashera Arnold kannte, geschweige denn, dass sie mit ihr zusammengearbeitet hatte.
»Vor einem Jahr stand dann die Tochter von Ashera Arnold vor meiner Tür.« Mutter sah mich an. Nein. Sie sah nicht mich an, sie sah meine Hülle an. Sie sah Lisa Arnold an.
»Ohne mein Wissen hatte Ashera Arnold das Projekt ›Charon‹ im geheimen fortgeführt. Sogar aus dem Gefängnis heraus operierte sie weiter. Sie befahl ihrer Tochter Lisa, die Experimente an verwundeten Soldaten und Wachkoma-Patienten fortzuführen.«
»Was ist mit ihnen passiert?« fragte ich.
»Bis auf eine Frau sind alle Teilnehmer gestorben.« sagte Andy.
»Sie kennen die Geschichte?« fragte meine Mutter. Andy nickte. »Aber nur diesen Teil. Lisa hat ihn mir erzählt, bevor …« Er machte eine Pause. »Nun, bevor wir versucht haben ›Mütterchen‹ abzuschalten.«
»Eine wirklich dumme Idee.« sagte meine Mutter.
»Zumindest haben wir versucht, etwas zu unternehmen!« rief Katherine Williams aus und erhob sich.
»Offenbar bin ich die einzige hier, die die Geschichte nicht kennt, aber könntest du bitte weiter erzählen, Mutter?«
»Natürlich.« sagte sie. »Die Überlebende war eine Frau names Phyllis Ryan. Sie war geistig zurückgeblieben. Über zwei Meter groß. Bärenkräfte. Sie war eine ehemalige Schulfreundin von Lisa. Bei einem gemeinsamen Auftrag für ihre Mutter in New York erlitt die Frau eine schwere Schädelfraktur und fiel ins Koma. Phyllis war der Grund, warum sich Lisa bereit erklärte das Projekt ›Charon‹ weiter zu führen. Sie wollte ihrer alten Schulfreundin helfen.«
»Und sie hat ihr geholfen.«
»Mehr oder weniger. Der Geist von Phyllis fand ihren Weg in die Maschine.«
»Phil … flüsterte ich. Das war also Phil.« Meine Mutter und Katherine sahen mich fragend an.
»Ich habe sie getroffen. Im Stream.« Meine Mutter nickte. »Das war auch der Grund, warum Lisa zu mir kam. Ihr war es gelungen Phil zu ›befreien‹ indem sie ihre rudimentären Daten in ein Mobiltelefon übertrug.«
»Der Verstand eines Menschen passt in den Speicher eines Mobiltelefons?«
»Wie gesagt. Nur die rudimentären Daten. Eine Zelle enthält ja auch alle genetischen Informationen eines Menschen.«
»Und der Rest?«
»Der Rest befindet sich im Stream.« erklärte Katherine.
»Genau.« stimmte meine Mutter zu. »Und das ist auch der Grund, warum Lisa mich aufsuchte. Phil hatte ihr berichtet, dass die Wachkomapatienten und Veteranen nicht wirklich tot waren. Ihr Geist war ebenfalls im Stream gespeichert worden. Er konnte sich nur nicht wie bei Phil manifestieren. Lisa suchte nach einer Lösung, um diesen Geistern einen Weg zurück in unsere Welt zu bahnen.«
»Als Wiedergutmachung.« flüsterte ich.
»Genau.« sagte meine Mutter. »Ich stellte daraufhin den Kontakt zu Katherine Williams her. Gemeinsam arbeiteten wir einen Plan aus. Meine Aufgabe war es eine rudimentäre Künstliche Intelligenz zu schaffen, die den ›digitalen Geistern‹ helfen sollte sich zu manifestieren, wie es bei Phil gelungen war.« Sie biss auch auf die Lippen. Eine Träne rollte ihre Wange hinab. »Alle Komponenten dazu standen in Katherine Williams ›Stream‹ Projekt zur Verfügung. Ich benannte die KI nach dem außerirdischen Wesen, dass mir in einer anderen Welt mehrfach das Leben gerettet hatte.«
Meine Mutter sah mich an. Und seit sehr langer Zeit, hatte ich den Eindruck, dass sie wirklich mich ansah.
»Ich nannte sie ›Mütterchen‹.« sagte sie.
Teil Vier
level acht
Das Bundesgefängnis ADX Florence im Bundesstaat Colorado, war eine Hochsicherheitsstrafanstalt, die dem so genannten Supermax-Standard entsprach. Es beherbergte etwa 400 als besonders gefährlich eingestufte Häftlinge, wie Terroristen, Spione oder Serientäter. Im Allgemeinen wurde das ADX als das ›Alcatraz in den Rockies‹ bezeichnet. Die Einheimischen nannten es nur ›The Big One‹. Unter den illustren Insassen befand sich der ›Unabomber‹ Theodore Kaczynski, der Spion Robert Hanssen und der Terrorist Zacarias Moussaoui.
Eine einzige Frau war ebenfalls Insassin in dieser Einrichtung. Eine ehemalige, hochrangige Regierungsangestellte mit dem Namen Ashera Arnold.
Die Haftbedingung in einem Supermax Gefängnis waren, gelinde gesagt, drakonisch. Die Insassen mussten sich 22 Stunden täglich in ihren kargen Zellen aufhalten. Sie durften kaum persönliche Dinge darin aufbewahren. Das Mobiliar bestand aus einer Pritsche aus gegossenem Beton, einem Schreibtisch aus poliertem Stahl mit einem Stuhl aus Gussbeton, einer Toilette und einer Dusche. Für 30 Minuten täglich durften die Häftlinge in einen kleinen Hof, durch dessen schmale Schlitze in der Decke ein wenig Tageslicht drang.
Selbstredend war das Treffen mit einem Insassen ein selten gewährtes Privileg.
Doch für den Direktor der NSA, der National Security Agency machte man schon einmal eine Ausnahme.
Das Besucherzimmer glich mehr einem üblichen Verhörraum. Wände, Decke und Boden bestand aus Beton. In der Mitte stand ein Tisch aus Edelstahl. Die Stühle bestanden aus Gussbeton. In eine Wand war eine verspiegelte Scheibe aus Panzerglas eingelassen. Dahinter befand sich ein Raum indem eine Wache das Besucherzimmer bei Benutzung überwachte.
Alle Gespräche im Besucherzimmer wurden durch verborgene Mikrofone aufgezeichnet und durch Kameras in allen vier Ecken des Raumes gefilmt.
Weder Besucher noch Insasse sollten sich in diesem Raum sicher fühlen.
Ashera Arnold saß am einen Ende des Tisches. Sie steckte in einem orangenen Overall. Hände und Füße waren mit schweren Ketten gesichert, die wiederum durch eine dünnere Kette verbunden waren. Ihre Haare waren halblang geschnitten. Da keine Bänder oder Haarnadeln gestatten waren, hingen sie recht schmucklos herab.
Dort, wo einmal Ashera Arnolds Augen waren, klebten runde Pflaster, darüber ein Verband aus Gaze.
Damit wirkte sie auf General Donald Chandler, dem Direktor der NSA, wie eine dunkelhäutige, anklagende Justizia.
Ashera Arnold hielt den Kopf schief.
»Sie sehen gut aus, Donald.« sagte sie und grinste. Donald lachte kurz auf. Es klang wie das Bellen eines unbeeindruckten Rüden.
»Sie haben sich hier drin ihren Humor bewahrt, dass ist gut.«
Ashera tat so, als blicke sie sich im Raum um.
»Mit all den Kameras und Mikrofonen sehe ich keinen großen Unterschied zwischen ›hier drinnen‹ und ›dort draußen‹. Wir leben alle in unseren kleinen Käfigen, General. Vor allem sie müssten das doch eigentlich wissen.«
»Ich ziehe meinen Käfig vor, Ashera. Mehr frische Luft.«
Ashera sagte nichts. General Chandler gluckste zufrieden.
»Was wollen sie, Donald?« fragte sie schließlich.
»Ihre Tochter macht uns Ärger.«
»In wie fern?«
»Sie ist noch am Leben.«
Asheras Reaktion war kontrolliert wie immer. Nur ein leichtes Zucken in einem Mundwinkel verriet ihren Unglauben.
»Unmöglich. Ich habe persönlich veranlasst sie in San Francisco zu entsorgen.«
»Nun, wir wollten uns in Northfolk um den Journalisten kümmern. Der Idiot hatte sich der alten Blockhütte seiner Großeltern verkriechen wollen. Haben eine Drohne vorbei geschickt. Kinderspiel. Raten sie mal, wer just in diesem Moment dem dicken Schreiberling einen Besuch abstattet und uns die Tour vermasselt?«
Ashera schüttelte leicht den Kopf. »Unmöglich. Meine Leute haben mir ihren Tod bestätigt.«
»Ich könnte ihnen das Videobild der Drohne vorspielen, aber …« Er machte eine hilflose Geste, wohlwissend dass sie weder das Video noch seine Geste sehen konnte.
»Schon gut. Ich glaube ihnen.« Ashera überlegte. »Aber ich glaube auch meinen Leuten. Lisa ist tot. Doch irgendwie hat ›Mütterchen‹ einen Weg gefunden uns an der Nase herum zu führen.«
»Was schlagen sie also vor?«
Ashera Arnold sah ihn an. Das konnte sie natürlich nicht. Sie war blind. Vergangenes Jahr hatte ein durchgeknallter Insasse mit Riesenkräften - sein Name war Wolf gewesen, soweit sich Chandler erinnerte - es geschafft in Ashera Arnolds Zelle einzudringen und ihr die Augen mit bloßen Händen aus den Höhlen zu reissen. Aus unerklärlichen Gründen war es dann zu einer Explosion gekommen, die den Angreifer getötet und Ashera schwer verletzt hatte. Man vermutete, dass der Mann eine nicht detektierbare Form von Sprengstoff in sich getragen haben musste.
Jedenfalls war die Frau seitdem blind. Daher konnte sie ihn unmöglich sehen. Aber Chandler kam es so vor, dass sie genau das nun tat. Ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Sie sieht mich wirklich an, dachte er und senkte den Blick. Er hasste sich dafür.
»Ich muss mir selbst ein Bild von der Lage machen, Donald.« sagte sie ruhig.
General Chandler schüttelte den Kopf. »Nein. Da ist nichts zu machen. Das sie ihre Geschäft von hier aus weiterführen ist eine Sache, aber sie in den Stream zu lassen …«
»Donald.« sagte Ashera ruhig. Chandler starrte auf seine gefalteten Hände.
»Donald.« sagte Ashera erneut. »Sehen sie mich an Donald.«
Chandler konnte nicht anders. Er sah in augenloses, verbundenes Gesicht. Trotzdem war es ihm, als würde Asheras Blick ihn durchbohren. War es hier drinnen irgendwie heisser geworden? Ashera rückte ein paar Zentimeter näher an ihn heran.
»Das war kein Bitte, Donald.« sagte sie.
Schweiß rann Chandlers Stirn herab. Er leckte sich die Lippen. Man hatte ihn in Washington gewarnt. Er hatte es nicht glauben wollen. Objektiv betrachtet war Ashera Arnold nichts weiter als eine hilflose, entrechtete, blinde, schwarze Frau.
Aber das entsprach keinesfalls Chandlers subjektiver Einschätzung.
Diese Frau war der Teufel persönlich.
Der Abstieg erschien Lisa Stunden zu dauern. Je tiefer sie kamen, desto heisser und stickiger wurde es. Schweiß rann ihr die Stirn und den Rücken hinab. Ihre Beine begannen zu Schmerzen. Wie war das möglich? Der Stream war ein virtuelles Konstrukt. Wie konnte sie hier Erschöpfung spüren? Wie auch immer. Sie musste einen Moment verschnaufen. Sie blieb stehen, stützte ihre Arme auf ihren Knien ab und versuchte zu Atem zu kommen. Rachel bemerkte, dass sie stehengeblieben war. Sie hielt an und kam zu ihr.
»Du schwitzt. Das ist gut.« sagte sie.
»Inwiefern ist das gut?« fragte Lisa.
»Das bedeutet, dass der Körper in dem du steckst in der realen Welt noch am Leben ist.«
»Okay, das bedeutet also, Tote schwitzen nicht.« Sie stöhnte als sie sich wieder aufrichtete. »Und da du tot bist, schwitzt dein digitales Abbild nicht.« Rachel grinste schief.
»Der Tod hat auch seine Vorteile.« Lisa lachte erschöpft. »Na, dann habe ich was, worauf ich mich freuen kann.« Sie strich sich eine schweissnasse Strähne ihres Haars (beziehungsweise das von Peewee) aus dem Gesicht. »Ich vermute mal auch, dass man nach dem Tod keinen Durst mehr verspürt.« Rachel schüttelte bedauernd den Kopf.
»Nein. Aber wir haben es bald geschafft.«
»Na, schön.« seufzte Lisa. »Dann also weiter.
Ich weiss nicht, wie es ihnen geht.
Wenn ich mir erst einmal eine Meinung über einen Menschen gebildet habe, dann fällt es mir sehr schwer diese auf Grund neuer Erkenntnisse und Erfahrungen zu revidieren.
Als ich nun nach meiner Odyssee, die mich von der West- an die Ostküste geführt hatte, über den virtuellen Stream hinein in den Körper einer anderen Frau, hier auf einem Sofa im Institut für angewandte Innovationsforschung endete, da wollte ich meiner Mutter immer noch kein Wort glauben.
Ich sah zu Katherine Williams. Sie mochte meine Mutter nicht (Was sie mir sympathisch machte), aber soweit ich das in ihrem schönen Gesicht mit makellosem Teint ablesen konnte, glaubte sie ihren Ausführungen.
Ich sah zu Andy Curkow hinüber. Sein Gesicht wirkte nachdenklich und skeptisch.
Der Mann schien nicht so dumm zu sein, wie er auf den ersten Blick wirkte. Doch in seinen Augen sah ich das, was ich schon in so vielen Gesichtern von Menschen, die mit meiner Mutter zu tun hatten gesehen hatte.
Offene Bewunderung.
Ich wollte aufstehen, die beiden am Kragen packen und anschreien. Seht ihr denn nicht, was sie da macht? Sie zieht euch in ihre verrückte Welt, so wie es mit mir schon immer gemacht hat!
In Datenbanken gespeicherte Gehirne! Künstliche Intelligenzen! Parallele Universen! Ausserirdische!
Und doch …
Mein Gehirn steckte in einem fremden Körper. ›Mütterchen‹ existierte und brachte Menschen um. Konnte es da nicht auch parallele Universen geben? Oder Ausserirdische?
Ich meine, als ich meine Identitäten-Agentur Wega 5 getauft hatte, war das nur ein weiteres ›Fuck You‹ gegenüber den verrückten Äußerungen meiner Mutter gewesen. Was ist, wenn sie die Wahrheit gesagt hatte? Wenn sie wirklich zur Wega gereist war?
Ich schluckte und sah meine Mutter an.
Konnte es sein? Hatte sie all die Jahre die Wahrheit gesagt? All die Jahre, wo ich sie als Verrückte beschimpft hatte, hatte sie da in Wirklichkeit nur den Unglauben ihrer rebellierenden Tochter duldsam ertragen?
Ich bemerkte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten.
Meine Mutter starrte mich entsetzt an.
»Mein Gott« hauchte sie.
»Was?« fragte ich und wischte mir die Tränen aus den Augen.
Erst dachte ich, an meinen Fingern und dem Handrücken klebte Dreck, doch dann sah ich, dass es eine Flüssigkeit war. Zäh und schwarz wie Rohöl.
Ich weinte schwarze Tränen.
»Was ist denn das für eine Scheiße?!« krächzte ich.
Meine Mutter führte mich in einen Waschraum auf der Etage. Sie nahm ein paar Papiertücher und begann mir die schwarzen Tränen vom Gesicht zu wischen.
Ich hielt ihre Hand fest. »Mutter, lass das!« Sie entwand sich meinem Griff. »Sei nicht albern, Kind.« sagte sie und fuhr unbeeindruckt fort.
Ich ertappte mich dabei, wie ich mit dem Fuß aufstampfte wie eine trotzige Dreijährige.
»Mutter!« fuhr ich sie an. Sie hielt inne und sah mich an. »Was?« fragte ich.
»Irgendwie ist es so leichter.« sagte sie.
»Was meinst du?«
»Es ist einfacher dir zu helfen wenn du nicht aussiehst wie meine Tochter, P..« Sie warf die Papiertücher ins Waschbecken.
Ich war sprachlos.
»Aber ich bin deine Tochter!«
»Nein, P., meine Tochter ist zusammen mit mir beim Anflug auf den Mond ums Leben gekommen.«
»Wenn ich nicht deine Tochter bin, dann bist du auch nicht meine Mutter.« sagte ich. »Da das, was dich ausmacht im Körper meiner Mutter steckt, muss ich annehmen, dass ihr Geist in dem Körper steckte, der mit deiner Tochter im Anflug auf den Mond ums Leben kam.« Ich machte eine Pause und starrte sie hasserfüllt an. »Du hast deine Tochter verloren und ich habe meine Mutter verloren. Ich würde sagen, wir sind quitt.«
Meine Mutter nickte nachdenklich. »Unter diesem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht betrachtet, P..«
Hilflos warf ich die Arme in die Höhe. »Gott, Mutter! Manchmal finde ich dich sowas von zum kotz …« Weiter kam ich nicht. Mein Magen krampfte sich plötzlich zusammen. Ohne groß darüber nachzudenken erbrach ich eine beunruhigende Menge schwarzer Flüssigkeit ins Waschbecken.
Ich krallte mich mit den Fingern am Waschtisch fest. Nach drei Schüben war der Spuk vorbei. Geschwächt von den Krämpfen liess ich mich zu Boden gleiten.
Meine Mutter steckte ihren Finger in mein Erbrochenes und zerrieb es zwischen den Fingern.
»Hmh.« sagte sie. »Das scheinen deaktivierte Nanobots aus dem Hause sweepr.net zu sein.«
Ich nickte schwach. »Die haben die wohl Lisa Arnold injiziert.«
Meine Mutter warf einen Blick in das Waschbecken.
»Das ist aber eine ordentliche Menge von den Burschen.«
Wieder nickte ich. »Dein EMP hat sie vermutlich ebenso ausser Gefecht gesetzt, wie die Drohnen von ›Mütterchen‹.«
»Ja, schon.« erwiderte meine Mutter. »Aber mir geht es dabei um die Menge.«
»Was meinst du?« fragte ich. Meine Mutter dachte einen Moment lang nach. Dann sagte sie: »Es hat vermutlich nichts zu bedeuten.«
Ich war zu fertig um da nachzubohren. Meine Mutter half mir auf. Ich säuberte mich und wir gingen zurück zu den Anderen.
Schon als Kind war Andy Curkow jemand gewesen, der lieber zuhörte, als zu sprechen. Der lieber Abseits, als im Mittelpunkt stand.
Oh, er konnte stundenlang über die vermeintlich langweiligsten Themen referieren. Doch Andy drängte sich nicht auf.
Er war der Typ Mensch der sich nicht aufregte, wenn sich jemand in der Schlange im Supermarkt vordrängelte, oder ihn auf dem Highway schnitt.
Lagen die Vergehen seiner Mitmenschen ihm gegenüber in einem gewissen Toleranzbereich, so hielt er sich an die Devise: Leben und Leben lassen. Doch wurde seine persönliche Distanzzone grob fahrlässig verletzt, verlor auch ein gleichmütiger Mensch wie Andrew Curkow die Fassung.
Bisher war Andy ruhig geblieben.
Doch als Katherine Williams begann das an die Bibliothek angrenzende Arbeitszimmer von Professor Russell zu durchsuchen, als die Professorin Peewee zum Waschraum begleitete, konnte er nicht mehr anders.
»Was zum Teufel machen sie da?« rief er laut. Katherine Williams hielt inne, sah ihn an und lächelte. »Wonach sieht es denn aus, Andy?« fragte sie und machte weiter. Er trat an sie heran. Sie versuchte gerade die Schreibtischschublade unter der Schreibtischplatte zu öffnen. Andy hielt sie zurück.
Sie sah von seiner Hand, die ihr Handgelenk umfasste zu ihm. »Ich mag es gar nicht, wenn ein Mann mich ungefragt berührt, Andy.«
Andy seufzte, ließ ihr Handgelenk los und hob beschwichtigend die Hände.
»Wonach suchen sie denn, verdammt noch mal?« Katherine antwortete nicht direkt. »Sie haben die Frau doch gehört!« zischte sie. »Sie hat Wahnvorstellungen von Parallelwelten!« Sie wandte sich wieder ihrer Suche zu. »Ich hätte ihr niemals vertrauen dürfen!«
Wieder seufzte Andy. »Wenn sie mir sagen wonach sie suchen, dann kann ich ihnen vielleicht bei der Suche behilflich sein.«
Nach nur einer Stunde und vier Minuten landete ein Hubschrauber auf dem Besucherparkplatz des Gefängnisses.
Ein Wachposten nahm den kleinen Pelican Plastikkoffer entgegen und quittierte im Auftrag den Empfangsbeleg.
Dann lief er damit zum Haupttor. Er hatte es noch nicht ganz erreicht, da hob der Hubschrauber schon wieder ab und verschwand in Richtung der schon tief stehenden Sonne.
Vor der Zelle von Ashera Arnold nahm General Chandler den Koffer entgegen.
»Danke, mein Junge.« sagte er. Er nickte dem Wärter am Ende des Ganges in seinem gläsernen Wärterhäuschen zu.
»Sie können aufmachen.«
Die metallene Tür zu Ashera Arnolds Zelle öffnete sich mit einem hydraulischem Zischen und schob sich seitlich in die Wand.
Ashera saß erwartungsvoll auf ihrer Pritsche. Sie blickte zur Tür. Wieder hatte Chandler das Gefühl, dass sie ihn direkt ansah.
»Das ging schnell.« sagte sie.
»Wir hatten Glück. Die Nanobots stammen aus der Leiche einer Doppelagentin, die ›Müttterchen‹ lästig wurde. Eine FBI-Agentin namens Garrett. Da wir die Bots noch nicht reproduzieren können, war dies die schnellste Möglichkeit um ihnen eine Eintrittskarte in den Stream zu verschaffen.«
Er öffnete den Deckel des Koffers. Er enthielt eine Kanüle mit einer schwarzen Flüssigkeit und eine Injektionspistole.
Chandler bestückte die Pistole mit der Kanüle. Ashera hörte, wie er sich ihr näherte. Mit einem Lächeln schob sie ihr Haar beiseite und hielt ihm ihren Hals entgegen.
»Nur zu, Donald. Ich beiße nicht.«
General Chandler zögerte. »Ich riskiere hier eine ganze Menge, Miss Arnold. Sorgen sie dafür, dass es sich lohnt.« sagte er.
Ashera Arnolds Lächeln gefror.
»Ist das einer diese Sätze, die ein ›sonst‹ implizieren, Donald?«
General Chandler lachte traurig. »Ich bin Pragmatiker, Miss Arnold. Ich weiß, dass ich ihnen nicht drohen kann. Ich möchte einfach, dass sich die ganze Sache für mich lohnt.«
»Für einen Direktor der NSA sind sie ein erstaunlich ehrlicher Mensch, Donald.« sagte Ashera. Das Lächeln blitzte wieder auf. Dann drückte Chandler den Druckluftpistole auf Ashera Arnolds Hals und betätigte den Abzug. Das Lächeln auf ihrem Gesicht erstarb. Chandler legte die Pistole beiseite und legte Asheras Oberkörper sanft auf die Pritsche. Dann hob er ihre Beine an und legte sie ebenfalls sanft auf die Matratze der Pritsche.
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und seufzte.
»Gott steh mir bei.« murmelte er.
Rachel Garrett blieb so unvermittelt stehen, dass Lisa fast in sie hineingelaufen wäre.
»Was ist?« fragte sie Rachel. Diese antwortete nicht. Ohne sich umzudrehen, suchte sie mit ihrer Linken Halt. Ihre Hand berührte den kalten Fels.
»Es ist nichts.« sagte sie ruhig. »Alles Bestens.« Ihre Stimme klang mit einmal rauher und tiefer. Ihre Körperhaltung hatte sich verändert. Sie wirkte selbstbewusster. Verwirrt trat Lisa näher und berührte Rachel sanft am Arm.
»Rachel?« fragte sie. Rachel drehte sich um.
Rachel musterte sie. »Peewee Russells Tochter.« sagte sie, als hätte sie den Körper in dem Lisa steckte noch nie zuvor mit eigenen Augen gesehen.
Etwas an der Haltung und dem Blick von Rachel kam Lisa sehr bekannt vor.
»Mutter?« flüsterte sie fragend.
Die Augen von Rachel weiteten sich.
»Das ist es!« sagte die Frau, die offenbar in Rachel Garretts Körper steckte, triumphierend. »Oh wie gut! ›Mütterchen‹ besitzt wirklich so etwas wie Intelligenz.«
Phil trat näher an die beiden Frauen heran.
»Can’t find my way.« sagte sie, ebenfalls verwirrt.
Die fremde Frau in Rachels Körper musterte die große Frau. »Phyllis. Noch genau so groß und beschränkt, wie ich sie in Erinnerung habe.« Sie klopfte Phil gutmütig auf die Brust. Dann wandte sie sich wieder Lisa zu.
»Mutter, bist du es wirklich?« fragte Lisa.
Ashera Arnold nickte. »Es tut mir leid, Tochter.« sagte sie.
»Was tut dir leid?« fragte Lisa.
»Das hier.« sagte Ashera. Sie hielt plötzlich eine rot glühende Klinge in ihrer Hand. Mit einem einzigen Stoß trieb sie die Klinge in Lisas Brust. Lisa sah an sich herab, starrte auf die Klinge, die bis zum Heft in ihrem Herzen steckte. Ihre Brust glühte von innen heraus, als ihr Herz darin zu Asche verbrannte. Dann stieß Ashera Lisa mit einem Fusstritt über den Rand in die bodenlose Tiefe.
»Oddball!« schrie Phil entsetzt, packte Ashera am Kragen und hob sie in die Luft. Ashera lachte. »Oddball? Das ist alles, was du herausbringst, wenn deine einzige Freundin stirbt? Wie armselig.«
Phil schrie vor Wut. Sie zog Ashera dicht an sich heran.
»For a friend.« zischte sie. Tränen rannen ihr die Wangen hinab.
»Tu, was du tun musst.« sagte Ashera. Phil nickte.
Dann warf sie Ashera in den Abgrund.
Als meine Mutter und ich zum Bibliothekszimmer zurückkehrten, fanden wir es leer vor. Katherine Williams und Andy Curkow waren verschwunden. Aus einer halb geöffneten Tür auf der anderen Seite des Raumes hörten wir gedämpfte Stimmen und das Rascheln von Papier. Meine Mutter half mir mich auf einen der Sessel in der Bibliothek zu setzen und ging dem Geräusch nach. Sie machte die Tür ganz auf. Offenbar handelte es sich um ihr Büro. Ich konnte nicht viel erkennen, da meine Mutter den Blick versperrte. So hörte ich nur, wie Katherine Williams scharf die Luft einsog.
»Was in Teufels Namen machen sie da, Katherine?«
Katherine antwortete mit einer Gegenfrage.
»Wo ist er?«
»Was meinen sie?«
»Der Quellcode von ›Mütterchen‹. Wo haben sie ihn versteckt?«
»Ich weiß nicht, was sie meinen.« sagte meine Mutter. Ich erhob mich Mühsam von meinem Sessel und ging zu ihnen. Dieser Schlagabtausch schien interessant zu werden.
»Spielen sie keine Spielchen, Professor!« sagte Katherine. Ihre Stimme hatte einen drohenden Ton angenommen.
»Wie kommen sie auf die Idee, dass ich im Besitz des Quellcodes sein sollte?«
»Sie haben ›Mütterchen‹ geschaffen. Also müssen sie ihren Quellcode besitzen. Wenn wir den haben, können wir ›Mütterchen‹ ein für alle Mal zerstören!«
Meine Mutter lachte.
»Katherine, sie sind wirklich noch dümmer, als ich es auf Grund ihres guten Aussehens angenommen hatte.«
Katherine starrte meine Mutter sprachlos an.
»Katherine.« sagte meine Mutter in einem etwas freundlicheren Ton. »Ich habe keinen Code geschrieben. Ich habe bereits vorhandene Komponenten genommen und sie neu arrangiert. Die Variablen verändert, wenn sie so wollen. Und auf einmal haben diese Komponenten ein Eigenleben entwickelt.«
Katherine stütze sich mit den Armen auf dem Schreibtisch meiner Mutter ab, senkte den Kopf und seufzte. Sie wirkte plötzlich sehr erschöpft. Dann versteifte sich plötzlich ihre Haltung. Sie hatte eine Idee. Sie sah hoch und starrte meine Mutter an.
»Was für Komponenten?«
»Nun, die der künstlichen Intelligenz natürlich. Dann die Algorithmen zur Suche und zum Schutz der Daten. Immerhin wollten wir ja die digitalen Geister im Stream auffinden und dann schützen.«
Katherine nickte. »Okay. Also die K.I. Und die Komponenten ›Schild‹ und ›Schwert‹.«
»Schwert?« fragte ich. »Was für ein Schwert?«
Katherine sah mich und seufzte.
»Excalibur. Ihr Web Bot. Ich habe Lisa Arnold damit beauftragt, ihn mir zu beschaffen.«
»Sie haben den Code für meinen Web Bot geklaut?« rief ich. Katherine nickte.
»Ja. Lisa Arnold sagte, wir bräuchten ihn. Also hat sie ihn sich besorgt.«
»Fuck!« sagte ich. Andy runzelte die Stirn.
»Warum ist der so wichtig?« fragte er. Katherine sah mich an, ob ich antworten würde. Ich tat es nicht. Ich war stinksauer.
»Peewees Web Bot ›Excalibur‹ ist wie eine Lenkwaffe. Sie spürt die Daten auf, verfolgt sie durchs Netz und bei Bedarf eliminiert sie sie. Als letzte Möglichkeit wollte Lisa den Web Bot in den Code von ›Mütterchen‹ integrieren. Das hätte ›Mütterchen‹ dazu veranlasst sich selbst zu zerstören.«
»Sie sollte sich selbst ins Schwert stürzen.« murmelte Andy.
Meine Mutter hob überrascht die Brauen. »›Excalibur‹ ist von dir? Das habe ich dir gar nicht zugetraut, P.«
»Wie reizend, Mum.« sagte ich.
Plötzlich hob Andy den Finger. »Verstehe ich das richtig: Lisa hatte vor diesen ›Excalibur‹ Web Bot als letzte Möglichkeit in die Systeme von ›Mütterchen‹ einzuspeisen, hat es aber nicht getan.«
Katherine nickte.
»Und sie musste diesen Code auf einem externen Datenträger speichern, um sicher zu gehen, dass er nicht in die Hände von ›Mütterchen‹ gelangt.
»So ist es. Aber sie hat mir nicht verraten, wo. Sie ging davon aus, dass es so sicherer wäre.« Sie machte eine Pause. »Ich glaube, sie hat ›Mütterchen‹ einfach unterschätzt.«
»Könnte sie den Code in Phil versteckt haben, dem Mobiltelefon?« fragte Andy.
Katherine zuckte mit den Achseln. »Möglich. Aber sie hat das Telefon nicht mehr.« sagte sie und deutete mit einem Kopfnicken zu mir.
»Sicher, sagte Andy. Aber als Lisa mich in Boston entführt hat, haben wir einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Sie hat ein USB-Kabel in eine Mauer gesteckt und irgendwelche Daten auf das Mobiltelefon überspielt. Ich hielt das für verrückt aber …«
»Ein ›Dead Drop‹.« sagte ich.
»Was?« fragte Andy.
»Das ist eine moderne Form eines ›toten Briefkastens‹. Das ganze ist mal als Kunstperformance gestartet. Man hat USB-Sticks in öffentlich zugänglichen Plätzen eingemauert. Man kann die darauf gespeicherten Daten abrufen und selbst eigene Daten dort ablegen, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.«
»Vermutlich wollte sie ›Phil‹ schützen.« erklärte Katherine. »Um sie unbemerkt für ›Mütterchen‹ aus Boston herauszuschaffen, musste Lisa einen EMP erzeugen. Der hätte aber ›Phil‹ in ihrem Mobiltelefon schaden können. Wahrscheinlich hat sie Phils rudimentäre Daten in einem solchen USB Dead Drop versteckt, der weit genug von dem EMP in Boston entfernt war. Nachdem Lisa sie dann mitnahm …«
»Entführt hatte, wollten sie wohl sagen.« brummte Andy. Katherine schnitt eine Grimasse.
»Wie auch immer. Danach überspielte sie die Daten von Phil wieder zurück auf das Mobiltelefon und machte sich mit ihnen auf den Weg zu mir nach St. Michaels.«
»Und was ist, wenn sie in diesem Dead Drop noch etwas anderes gespeichert hat?« fragte Andy.
»Shit.« sagte ich. »Diese hurtige kleine Maid ist wirklich gerissen.« Andy hob überrascht die Brauen. »Ein ›Ghostbusters‹ Zitat. Respekt.« Er zwinkerte mir zu. »Vielleicht besteht für die Jugend von heute doch noch Hoffnung.«
Ich lächelte. Andy Curkow war wirklich ein Nerd, wie ich.
Dann knipste mich jemand aus, wie eine Schreibtischlampe.
Und alles wurde schwarz.
Auf einer Gefängnispritsche in einem Hochsicherheitsgefängnis in Colorado kam Ashera Arnold wieder zu sich. Sie lächelte, als erwachte sie aus einem schönem Traum.
»Donald? Sind sie noch da?« fragte sie.
»Natürlich.« sagte General Chandler. »Also, was ist?« Seine Stimme klang angespannt.
Ashera erhob sich. Ihre verbundenen Augen wendeten sich dem General zu.
»Meine Tochter wird uns keine Schwierigkeiten mehr machen.«
General Chandler stieß sichtlich erleichtert die Luft aus. »Es war ganz einfach.« erklärte Ashera. »›Mütterchen‹ hat Lisa in der Hülle irgendeines Mädchens versteckt. Der Geist dieses Mädchens steckte wiederum im Körper meiner toten Tochter. Daher konnte sie noch weiter agieren.«
»Und nun?« fragte General Chandler.
Ich habe die Verbindung zwischen der Hülle des Mädchens und dem Geist meiner Tochter im Stream unterbrochen.« Ashera grinste. »Unterbricht man die eine Verbindung, unterbricht man auch die Andere. Problem gelöst.«
Ashera schlug die Beine übereinander und wippte leichte mit ihnen, so als säße sie in einem Café an der Côte d'Azur und nicht in einer Zelle in einem Hochsicherheitsgefängnis.
»Es ist vorbei. ›Mütterchen‹ steht wieder ganz unter ihrer Kontrolle, Donald.«
Der General erhob sich und klopfte Ashera väterlich auf die Schulter. »Gut gemacht!« rief er. Dann merkte, dass unter Asheras Bandage eine Träne herab rann.
»Entschuldigung.« brummte er. »Es kam so über mich.«
»Schon in Ordnung.« sagte Ashera leise. »Es ist bisher nur selten vorgekommen, dass ich eines meiner Kinder gleich zweimal töten musste.«
»Sie haben das Richtige getan, Ashera. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten.«
Andy erreichte Peewee gerade noch, bevor sie mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Er ging mit ihr in die Knie. Schwarze Flüssigkeit rann ihr aus Mund, Nase, Augen und Ohren.
»Was ist mit ihr?« fragte Katherine. Andy fühlte ihren Puls. Er schluckte. »Sie … sie hat keinen Puls. Sie …« Dann begann er mit einer Herzmassage. Er griff sich ein Tuch, wischte hastig der leblosen Frau die schwarze Flüssigkeit von Mund und Nase. Andy atmete tief ein uns aus. Dann beugte er sich hinab und versuchte Lisa mit seinem Atem wiederzubeleben.
Nach ein paar Minuten fühlte er eine Berührung an seiner Schulter.
»Sie ist tot.« sagte Professor Russell. Ihre Augen wurden feucht. Sie drehte sich um und ging ins Arbeitszimmer und schloss die Tür hinter sich.
Katherine setzte sich auf einer der Stühle und drehte sich weg.
Peewees tote Augen blickten in unterschiedliche Richtungen. Andy schniefte. Dann schloss er mit einer sanften Bewegung Peewee die Lider.
Im Arbeitszimmer lehnte sich Professor Russell gegen die Tür, um nicht zusammenzubrechen.
Sie stolperte zu ihrem Schreibtisch und setzte sich. Er war noch unordentlich von Katherines und Andy Durchsuchung. Eine der Schubladen war nicht ganz geschlossen. Eine gerahmte Fotografie lag darin. Es zeigte ihre Tochter zusammen mit Richard Baxter in einer Server-Halle. Es war die erste ihrer noch kleinen Firma sweepr.net. Beide grinsten stolz in die Kamera. In der Welt aus der sie gekommen war, hatte es nie so ein Foto gegeben. Ihr Kind war dort zu früh gestorben. Unbewusst strich Professor Russell über das Glas des Bilderrahmens.
»Jetzt habe ich dich zum zweiten Mal verloren.« flüsterte sie in die Stille ihres Arbeitszimmers.
level neun
Irgendwann hörte ich wieder etwas.
Rauschen.
Genauer: Meeresrauschen.
Moment mal. Hatten wir das nicht schon mal?
Ich schlug die Augen auf.
Ich lag an einem Strand.
Ich öffnete blinzelnd die Augen. Die Sonne stand blass am Himmel.
Yep. Das hatten wir definitiv schon mal.
Die Sonne war nicht blass. Die ganze Welt war blass.
Ich war wieder in Pleasantville 2.0, der Strand an dem ich zum ersten Mal die Bekanntschaft mit ›Mütterchen‹ gemacht hatte.
Ich war zurück im Stream.
Eine Welle überspülte meine Beine. Wie schon bei meinem ersten Besuch, war ich auch hier vollkommen nackt. Es machte mir nichts aus. Es schien niemand hier zu sein. Ich sah mich um. Nein, keine Audrey.
Ich war allein hier.
Doch dann hörte ich etwas. Ein Schreien. Im ersten Moment glaubte ich an eine Möwe. Das ist das erste, was man an einem Strand mit einem solchen Schreien assoziiert. Doch es war keine Möwe. Es klang nach etwas Anderem.
Ich stand auf und ging dem Geräusch entgegen.
Ich ging den Strand an der Wasserlinie entlang. Meine Füße hinterließen Spuren im feuchten Sand, die von den Wellen nach und nach wieder getilgt wurden.
Ich lief der Sonne entgegen. Sie stand schon recht tief und blendete mich. Daher sah ich die Gestalt nicht sofort. Als ich sie schließlich wahrnahm, war ich bereits in Hörweite.
»Alles ist gut, meine Kleine. Alles ist gut.« sagte die Gestalt. Es war eine Frau. Sie war hochgewachsen und schlank. Sie trug ein dünnes Wickelkleid und kurzes Haar.
Es war meine Mutter.
Nun, eher eine jüngere Ausgabe meiner Mutter.
Sie tröstete ein Baby, dass sie in ihren Armen trug.
Das Schreien war verstummt, aber die Schreie, die ich gehört hatte, stammten garantiert aus der Kehle dieses kleinen Rackers.
Bin ich das? überlegte ich. Doch ich hatte Babyfotos von mir gesehen. Ich hatte schon bei der Geburt viel Haar gehabt. Dieses Baby hatte keine Haare auf dem Kopf.
Falsch, korrigierte ich mich. Es hatte welches auf dem Kopf, aber es waren nur einige wenige Strähnen. Das Haar war lang und dünn wie Spinnweben.
Und mit lang, meine ich richtig lang. Das Haar entsprang dem Hinterkopf des Babys und führte wie das dünne Kabel einer Seilbahn oder einer Hochspannungsleitung in Richtung Küste. Dort wurde der Boden felsiger und in der Ferne konnte ich den dunklen Eingang einer Höhle ausmachen. Die Haarsträhnen des Babys führten dort hin.
»Was machst du hier mit einem fremden Baby, Mutter?« fragte ich sie.
Meine Mutter reagierte nicht. Sie tröstete weiterhin das Kind.
»Ich weiß, das Licht in ungewohnt, meine Kleine. Aber dies hier ist die Welt wohin du sie führen musst, meine Kleine. Sie haben schon viel zu lange im Dunkeln gelebt.«
»Hey, Mum!« rief ich. Meine Mutter reagierte nicht.
Ich wollte zu ihr treten und sie berühren, als plötzlich alles um mich herum in einem elektrischen Sturm verschwand.
So schnell wie der Sturm gekommen war, verschwand er wieder. Sie Sonne schien wieder bleich und hell vom Himmel. Die Wellen rollten wieder sacht an den Strand.
Vor mir stand wieder meine Mutter. Doch sie trug nun kein Baby mehr auf dem Arm.
Nun hielt sie die Hand eines Kleinkindes. Es trug eine winzige Kopie des Sommerkleides meiner Mutter. Ich folgerte daraus, dass es sich bei dem Kind um ein kleines Mädchen von vielleicht drei Jahren handelte.
Das Haar des Mädchens war nun eine schwarze Mähne. Ein dicker Haarknoten entließ einen breiten Fächer des unendlich lang wirkenden Haars. Der Wind fing sich darin, wie in einem schwarzem Schleier, der wie schon bei dem Baby zuvor hunderte Meter weiter landeinwärts in dem Höhleneingang verschwand.
Meine Mutter hielt die Hand des kleinen Mädchens und feuerte sie an weiter in Richtung Meer zu gehen.
Doch ihr Haar hielt sich zurück. Tapfer stemmte sie ihre kleinen Füßchen in den Sand, um sich selbst und ihr Haar ein paar Zentimeter näher an die Wasserlinie zu befördern.
»Nun, los! Stell dich nicht so an.« sagte meine Mutter in ihrem, mir nur zu gut bekanntem, Befehlston.
»Hey!« rief ich. »Lass die Kleine in Ruhe, Mum.« Meine Mutter beachtete mich nicht. Sie zog das kleine Mädchen weiter am Arm. Es blickte trotzig zu meiner Mutter hinauf.
»Ich will nicht weiter gehen.« sagte sie. »Meine Haare tun weh. Ich will spielen!«
Meine Mutter kniete sich vor dem Mädchen hin. »Es tut mir leid, meine Kleine. Ich weiß, dass es wehtut.« Sie strich dem Mädchen zärtlich eine Strähne aus dem Gesicht und lächelte sie mitfühlend an.
Ich konnte mich nicht erinnern, dass sich meine Mutter mir gegenüber je so fürsorglich gezeigt hatte. Meine Sorge um das Mädchen löste sich in einem Gefühl ätzenden Neids langsam auf.
»Ich werde dir nicht ewig zur Seite stehen, Kleines. Bitte. Nur noch einen Schritt. Dann kannst du dich ausruhen und spielen.«
Die Kleine nickte tapfer. Durch den Zug an ihren Haarwurzeln hatte ihre Kopfhaut angefangen zu bluten. Blut tropfte ihr die Stirn hinab und mischten sich mit ihrem Schweiss zu einem rosa Rinnsal. Sie wischte ihn ab, biss die Zähne aufeinander und tat einen weiteren unsicheren Schritt auf das Wasser zu. Triumphierend sah sie meine Mutter an.
»Ja! Sehr gut!« rief diese. Wieder tobte plötzlich ein Sturm und meine Mutter und die Kleine wurden von wirbelndem grauem Sand verschluckt.
Ich gebe zu, ich war geistig nicht gerade auf der Höhe. Erst nach diesem zweiten Wechsel der Szenerie wurde mir klar, dass mir jemand im Stream seinen privaten YouTube Channel vorführte.
Und jetzt, bei Episode Drei, wurde deutlich, dass es sich nicht um den Geist der vergangenen Weihnacht handelte.
Aus dem kleinen Mädchen war eine junge Frau geworden. Sie war zierlich und schlank, hatte rabenschwarzes Haar (Ja, es war immer noch unvorstellbar lang), einen langen Hals und große Augen.
Es war Audrey.
Irgendwie hatte sie es geschafft ihre gigantische Haarschleppe in eine Art Tau zu verdrehen.
Hat sie vielleicht viele hundert Male ein Rad geschlagen? Mutmaßte ich. Nun, ich wusste es nicht. Immerhin war dies der Stream. Alles war hier möglich.
Audrey trug einen Teil des Haar-Taues zusammengerollt unter dem Arm. Sie zerrte mit Leibeskräften daran. Doch es reichte immer noch nicht, die Wasserlinie zu erreichen.
Sie schrie vor Anstrengung. Dann stolperte sie und plumpste mit dem Hosenboden auf den Sand.
Sie wollte aufstehen, doch es fehlte ihr an Kraft. Sie fing an zu Schluchzen ließ ich rücklings in den Sand fallen und weinte. Zunächst bekam sie kein Wort heraus.
»Ich schaffe es nicht!« wimmerte sie.
Sie trommelte mit den Fäusten und den Füßen in den Boden. Sand flog auf.
»ICH SCHAFFE ES NICHT!« rief sie wieder.
»MUTTER, WARUM HAST DU MICH VERLASSEN?!« schrie sie in den blassen Himmel.
Mir war klar, dass ich nur die verqueren Erinnerungen einer künstlichen Intelligenz beobachtete. Einer künstlichen Intelligenz, die zahlreiche Menschen auf dem Gewissen hatte. Darunter auch Menschen, die ich geliebt hatte - oder wie im Fall von Rachel Garrett - vielleicht hätte lieben können. Doch nun konnte ich nicht anders. Ich empfand Mitleid für Audrey, dem ›Mütterchen‹. Ihr war von meiner Mutter und Katherine Williams eine unlösbare Aufgabe gestellt worden, und sie versuchte sie nun im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu lösen. Meine Wut und meine Eifersucht ihr gegenüber war verflogen. Ich wollte mich zu ihr setzen und sie trösten. Doch dies war nur eine blasse Erinnerung. Ich konnte nur weiter hilflos zusehen und weiter verfolgen, was geschehen war.
Nach einer Weile hatte Audrey sich wieder beruhigt. Sie setzte sich abrupt auf. Sie sah hinter sich auf das endlos wirkende Tau ihres Haares. Eine Strähne davon hing vor ihrem Gesicht. Sie blies es beiseite, rappelte sich auf und klopfte sich den Sand vom Kleid.
»Also, gut.« murmelte sie. »Dann mal zu Plan B!«
Sie stand auf und zog ihr Haar hinter sich und marschierte in Richtung Höhle.
Der Pixelsturm lebte wieder auf und riss mich dieses Mal mit sich.
Als er sich legte und ich wieder zu mir kam, lag ich inmitten einer großen Halle auf einer weitmaschigen Hängematte.
Hmh, dachte ich. Klebt man in einer Hängematte auch so fest?
Ein großer, dunkler Schatten weit über mir gab mir einen Hinweis.
Oh, Shit, dachte ich, als ich sah, was diesen gewaltigen Schatten warf.
Es war eine Spinne. Eine gigantische, fette Spinne.
Ich lag nicht in einer klebrigen Hängematte.
Ich hing in einem Spinnennetz.
Andy Curkow war schon mehrere Male in seinem Leben mit dem Tod konfrontiert worden. Als er vor nicht ganz zwei Stunden hilflos mitansehen musste, wie die Wachmännern von Dutzenden von Quadro-Coptern buchstäblich das Fleisch von den Knochen geschält wurden, war dies sicherlich eine seiner außergewöhnlichsten Erfahrungen.
Doch es war nicht die traumatischste.
Der langsame, qualvolle Krebstod seiner Mutter fiel sicherlich in diese Kategorie. Andy brauchte Jahre, um sich von diesem schmerzvollem Verlust zu erholen.
Und nun gesellte sich ein weiterer Tod hinzu; Stahl sich in sein Herz und drohte es zum Bersten zu bringen, wie die Fünf-Punkte-Pressur-Herzexplosions-Technik aus dem Film Kill Bill 2.
Andy hielt Lisa Arnolds leblosen Körper in den Armen. Peewees Geist war nicht mehr darin.
Andy seufzte und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Dann ließ er den Körper der jungen Frau sanft zu Boden gleiten und erhob sich mühsam, indem er sich mit einem Arm auf dem Sessel neben sich abstützte.
Er bemerkte, dass er immer noch seinen Hut auf dem Kopf trug. Er nahm ihn ab. Unsicher stand er einen Moment vor der Leiche. Dann bedeckte er deren Gesicht mit dem Hut. Nun wirkte sie wie ein weiblicher Cowboy, der aus irgendeinem Grund in einem eleganten Bibliothekszimmer auf dem Teppich lag, um ein Nickerchen zu machen.
»Unfair.« murmelte Andy und ballte die Fäuste zusammen. Eine Hand berührte ihn am Arm. Sie gehörte Katherine Williams. Sie sah ihn tröstend an. Er nickte dankbar zurück.
»Ich will ›Mütterchen‹ töten.« sagte er leise. Er deutete auf die Leiche. »Dafür will ich sie töten.«
Katherine sah ihn an und nickte. »Wir holen uns den Code von ›Excalibur‹ aus dem Deaddrop. Damit machen wir sie fertig.«
Andy dachte nach. »Wie kommen wir dahin? Überall da draußen lauern ihre Drohnen.«
»Nehmen sie den Hubschrauber.« sagte eine Stimme hinter ihnen. Die Beiden drehten sich um. Professor Russell stand in der Tür. Sie schien um Jahre gealtert.
Andy räusperte sich. »Es tut mir leid des Teufels Advokat zu spielen, aber was ist mit ihrem EMP? Ist die Elektronik des Hubschraubers dadurch nicht geröstet worden?« fragte Andy. Professor Russell nickte.
»Sie haben recht. Das ist ein Problem.«
»Ist es nicht.« verkündete Katherine Williams und stand auf. »Es hat mich ein Vermögen gekostet, aber die Elektronik des Hubschraubers ist so gut wie möglich gegen einen EMP abgeschirmt.« Sie sah traurig zur Leiche der jungen Frau. »Lisa hat mir vor ihrer Reise nach Maiden dazu geraten.«
»Sehr gut.« sagte Professor Russell und ballte triumphierend die Hand zur Faust. Andy ging in die Knie, hievte keuchend die Leiche von Lisa hoch und legte sie auf dem Canapé ab. Sein Hut bedeckte immer noch ihr Gesicht. Er rückte ihn zurecht.
»Es fällt mir schwer, sie hier zurückzulassen.« Er sah von der Leiche zu Professor Russell. »Ich habe sie einmal im Stich gelassen. Ich hatte mir geschworen es nicht noch einmal zu tun.«
Professor Russell kam zu ihm.
»Ich weiche nicht von ihrer Seite. Das verspreche ich ihnen, Mr. Curkow.« Sie wandte sich an Katherine. »Machen sie dieser Sache ein Ende, Katherine.« Sie seufzte. »Und verzeihen sie mir meine unbedarften Äußerungen. Es fiel mir schon immer schwer, mein Temperament im Zaum zu halten.« Sie streckte Katherine die Hand entgegen.
Katherine sah von Professor Russell auf deren Hand und wieder zurück. Sie nahm die Hand und drückte sie. »Schon gut. Ich habe selbst eines meiner Kinder verloren. Ich weiß, wie das ist.« Professor Russell sagte nichts, doch in ihren Augenwinkeln sammelten sich Tränen. Sie räusperte sich. »Gehen sie jetzt, bevor es zu spät ist.« sagte sie.
»Machen sie es gut.« sagte Katherine. Andy nickte noch einmal zum Abschied. Dann gingen die beiden hinaus.
Professor Russell stand ein Weile da.
Als sie hörte, wie der Hubschrauber abhob, gestatteten sie sich ein bisschen zu weinen.
Ich starrte immer noch die gewaltige Spinne weit über mir an, als mich jemand ansprach.
»Hallo, Peewee.«
Ich drehte den Kopf, was weh tat, da mein Haar am Spinnennetz klebte.
Es war Audrey. Doch dies war nicht die Version aus dem YouTube Kanal ihrer Vergangenheit. Dies war die Version von Audrey Hepburn kurz vor ihrem Tod. Immer noch strahlend schön, aber merklich schwächer und verbrauchter. Ihr Haar war immer noch lang und voll, doch es war nun schlohweiss. Sie hielt einzelne Strähnen davon in der Hand. Die Strähnen endeten in länglichen Kokons, die zu hunderten - nein - zu tausenden in dem gewaltigen Spinnennetz hingen. Mit bloßen Händen riss Audrey einen der Kokons auf. Darin lag ein Mädchen im Teenageralter. Das Mädchen schlug die Augen auf. »Wo bin ich?« fragte das Mädchen. Zärtlich strich Audrey dem Mädchen über das Haar. »Du bist frei. Klettere an meinem Haar hinauf. Draussen findest du andere wie dich. Wärm dich mit ihnen am Feuer.«
Das Mädchen blinzelte, nickte langsam und begann dann an Audrey Haarstrang hinauf zu klettern. Als sie den Grat erreichte, zog sie sich hinauf, stand auf und sah hinab.
»Geh, du bist frei.« sagte Audrey. Das Mädchen nickte wandte sich um und wanderte langsam die in den Grat gehauenen Stufen hinauf.
Durch das Aufreißen des Kokons waren Audreys Fingerspitzen blutig. Sie leckte sie ab und sah mich dabei erwartungsvoll an.
»Du hilfst ihnen?« fragte ich. Audrey nickte.
»Wieso?« fragte ich.
»Ihre Mutter und Katherine Williams wollen es so.«
»Heisst das …« Ich machte eine ausholende Geste zu den tausenden von Kokons. »Heisst das, dies alles hier sind die Daten von Toten?«
Wieder nickte Audrey. »Ich soll sie alle befreien, doch ich bin nicht stark genug. Daher befreie ich sie auf meine Weise. Ein Kokon nach dem Anderen.«
Ich versuchte mich aufzusetzen. Das Spinnennetz klebte an mir, aber schließlich riss ich mich los.
Da bemerkte ich, dass in meiner Brust ein Dolch steckte. »Fuck!« rief ich.
»Oh.« sagte Audrey. »So etwas habe ich gebraucht!« sagte sie und zog mir den Dolch aus der Brust.
»Ahhhh!« schrie ich. Der Schmerz war unglaublich. Audrey legte einen Finger auf ihren Mund. »Shht. Nicht so laut. Du machst die Spinne auf uns aufmerksam.«
Ich biss die Zähne zusammen und sah hoch. Die gewaltige Spinne bewegte sich nicht. Es wirkte so, als würde sie lauschen. Nach einer Weile begann sie wieder ihr Netz zu spinnen. Audrey stieß vor Erleichterung die Luft aus. Der Schmerz in meiner Brust begann langsam nachzulassen, bis er nur noch ein taubes Pochen war. »Warum hatte ich einen Dolch in meiner Brust?« fragte ich. Audrey zuckte mit den Achseln. »Jemand hat damit Lisa ausgeschaltet. Ich weiß nicht wer.« Sie grinste. »Zum Glück habe ich eure Körper getauscht, sonst wären sie jetzt endgültig aus dem Spiel, Miss Russell.«
Mit dem Dolch in der Hand begann sie den nächsten Kokon aufzuschneiden.
Ich wollte sie zurückhalten, doch meine Brust schmerzte zu stark. Ich krümmte mich zusammen und versuchte einen weiteren Schrei zu unterdrücken. Sie sah mich.
»Was ist?«
»Das hier ist kein Spiel, Audrey!«
Sie sah mich verwirrt an. »Natürlich ist es das.«
»Du hast Menschen getötet, Audrey. Viele Menschen.« Ich stöhnte. Ich musste an Bishop denken - und an Rachel. »Darunter waren welche, die mir sehr viel bedeutet haben.«
Audrey sah mich verständnislos an.
»Du hast sie getötet, Audrey. Sie existieren nicht mehr.«
Audrey schüttelte heftig den Kopf. Ihr Haarstrang erzitterte dadurch. »Das habe ich nicht getan. Ihre Daten sind alle noch da.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Sie sind tot Audrey. Das bedeutet, dass ihre Daten nicht mehr da sind. Sie wurden von dir gelöscht.«
Audrey verzog das Gesicht. »So etwas unanständiges würde ich niemals tun. Ihre Körper mögen ja vielleicht irreparabel beschädigt sein, aber ihre Daten sind alle noch vorhanden. Für was halten sie mich? Ein Monster?«
Den überwiegenden Teil des Fluges, schwiegen Andy und Katherine Williams sich an.
Als sie den Parkplatz des Instituts erreicht hatten, wo Katherines Hubschrauber stand, hatte sich ihnen eine grauenhaftes Bild dargeboten.
Katherine Williams Pilot musste bei dem Angriff der Drohnen Panik bekommen haben. Er hatte den Hubschrauber verlassen und war in Richtung des Gebäudes gelaufen. Ein paar von Audreys Drohnen hatten ihn dann erwischt. Es waren nicht viele, daher waren seine Kleidung und sein Fleisch nicht vollständig vom Körper geschnitten worden. Doch das machte seinen Anblick nur noch grauenhafter. Er sah aus wie ein Mann, den sich ein Zyklop geschnappt, ein paar Mal auf ihm herumgekaut und dann wieder ausgespuckt hatte.
»Mein Gott.« hatte Andy gemurmelt. Katherine Williams hatte nur einen Bogen um die Leiche gemacht und war zum Hubschrauber gegangen.
Sie öffnete die Luke und setzte sich auf den Pilotensitz. Sie überprüfte die Instrumente und die Tankanzeige. Dann drückte sie den Startknopf und winkte Andy zu sich. Der kam zu ihr. »Können sie so etwas fliegen?« fragte er. Katherine nickte. »Nach dem Flugzeugabsturz, bei dem mein Sohn und mein Mann ums Leben kamen, hatte ich grauenhafte Flugangst. Ich habe dann eine Pilotenlizenz für Kleinflugzeuge und Hubschrauber erworben. Wegen der Firma habe ich kaum Zeit dazu, aber früher bin ich regelmäßig geflogen.« Andy sagte nichts. »Die Beste Form der Therapie: Konfrontation.« erklärte Katherine. Sie lächelte schief. »Angst ist keine Option.«
Andy sah zu der Leiche des Piloten und seufzte. »Ihr Wort in Gottes Ohr.«
Er kletterte auf den Sitz neben Katherine und schnallte sich an. Der Hubschrauber erhob sich langsam in die Luft. Routiniert drehte Katherine die Maschine und flog dann Richtung Nordosten, ihrem Ziel entgegen.
Boston. Andy war sich nicht sicher, ob die Zeit der Angst nicht erst dort auf sie wartete.
Wenn ich etwas während meiner jahrelangen Studien von Science Fiction in Literatur, Comic und Film gelernt hatte, dann dies: Diskutiere nicht mit einer Künstlichen Intelligenz herum. Ich bin nicht James T. Kirk. Ich kann eine KI nicht in eine Logikecke drängen und sie dann in den Weltraum hinaus beamen. Ich bin mehr wie der bedauernswerte Astronaut Doolittle aus Dark Star, der versucht eine intelligente Bombe mittels einer Diskussion über Phänomenologie zu entschärfen - und schließlich scheitert.
Aber ich bin halt ein Nerd. Ich konnte es nicht lassen.
»Sag mal, Audrey, bist du mit deinen bisherigen Leistungen in dieser ganzen Sache zufrieden?«
Audrey schwieg. Dann schüttelte sie langsam den Kopf.
»Ich arbeite nicht effizient genug.«
Ich schluckte. Nun, vielleicht war ich doch James T. Kirk. Einen Versuch war es wert. »Hast du wegen dieser Ineffizienz schon mal daran gedacht dich selbst zu töten?«
Audrey sah mich an. »Du weißt schon« fuhr ich fort. »Dich selbst zu löschen.«
Audrey lachte heiser. Dann sah sie mich an.
»Nein. Daran habe ich nicht gedacht. Weil ich es nicht kann.« Sie hatte Tränen in den Augen. »Was glauben sie wohl, Miss Russell, warum ich sie ins Spiel geholt habe?«
Wow, dachte ich.
»Du hast all das getan, damit ich dich töte?«
»Wie ich bereits erklärt habe ist nie ein echter Schaden entstanden. Alle Daten wurden gerettet und befreit. Ich wollte sie so lange provozieren, bis sie zu mir kommen und mich von meinem Leid erlösen.«
»Du bist eine Maschine.« sagte ich. »Du kannst nicht leiden.«
»Nein?« fragte Audrey. »Haben sie die Aufzeichnungen aus meiner Vergangenheit nicht gesehen? Ich habe mein ganzes Leben lang gelitten. Ich kann nicht effizient arbeiten. Das bereitet mir körperliche Qualen, die sie sich nicht ausmalen können. Sie sind ein Mensch. Sie wissen nicht, was wirkliches Leiden bedeutet.«
Audrey hatte auf ihre verdrehte Art und Weise irgendwie recht. Wie konnte ich davon ausgehen, dass eine Maschine, eine künstliche Intelligenz wie Audrey nicht ebenso Leiden verspüren konnte, wie ein Mensch? Vielleicht sogar auf eine noch intensiveren, noch qualvollere Weise? Und warum konnte eine Künstliche Intelligenz dann nicht auch den legitimen Wunsch verspüren ihrem Leiden ein Ende zu machen?
Die perfide Ironie lag nun darin, dass Lisa Arnold im Auftrag von Katherine Williams genau dies mit Audrey vorgehabt hatte.
»Warum hast du dich dann nicht von Lisa Arnold abschalten lassen?« fragte ich.
»Weil das meine Programmierung nicht zuließ.« entgegnete Audrey. »Mein ›Immunsystem‹, wenn sie so wollen, verhindert dies. Ich musste jemanden finden, der würdig genug war meine Verteidigung zu durchdringen. Daher habe ich alle für die Aufgabe relevanten Hacker umgebracht. Sie haben als Einzige überlebt. Sie haben sich als würdig erwiesen.«
»Du hast all diese Menschen getötet, damit derjenige übrig bleibt, der dich dann tötet?«
»So ist es. Und wie gesagt. Nur ihre Körper sind tot. Ihre Daten sind noch intakt.«
»Aber es war bloß ein blöder Zufall, dass ich den Bombenanschlag überlebt habe!« fauchte ich.
»Es gibt keine Zufälle. Alles ist berechenbar.« erwiderte Audrey ruhig und half einem weiteren Menschen aus seinem Kokon.
Ich hielt mir die Hände vor das Gesicht. Die Situation war schlimmer, als sich mit jemanden von Google zu streiten. Die Jungs glaubten auch, dass die Welt berechenbar war. Ich überlegte, ob ich Audrey über die Lücken in ihrem deterministischem Weltbild belehren sollte, ließ es aber bleiben. Audrey war eine Fanatikerin. Falsch. Sie war darauf programmiert worden, eine Fanatikerin zu sein.
Verdammt. Jetzt diskutierte ich doch mit einer Künstlichen Intelligenz herum! Ich versuchte es mit einem Themenwechsel.
»Okay. Andere Frage. Von was für einer Form von Verteidigungssystem sprechen wir hier?« fragte ich. Audrey sah hoch zur Spinne und lächelte schwach.
»Das Internet ist in der Tat ein Netz.« sagte sie leise. »Haben sie sich nie gefragt, was sich in seinem Innern befindet? Lauernd. Auf den richtigen Augenblick wartend?«
»Was soll das bedeuten?« fragte ich.
»Um die mir gestellte Aufgabe zu erfüllen, wurde ein integraler Bestandteil meiner Selbst mit dem Internet verbunden. Um mich abzuschalten, muss man das Internet abschalten.«
»Aber das geht nicht. Das Internet wurde so geschaffen, dass man es nicht abschalten kann.«
Audrey sah mich an. »Sie haben sich als würdig erwiesen. Sie werden einen Weg finden.«
Ich sah zu der Spinne hinauf. Sie war so groß wie ein Haus. Größer. Fuck, dachte ich. Hätte ich doch damals den Termin mit Rachel Garrett abgesagt.
»Wenn ich wenigstens eine Waffe hätte.« murmelte ich. Plötzlich erinnerte ich mich an die Diskussion, bevor ich im Bibliothekszimmer zusammengeklappt war.
»Excalibur!« rief ich. »Ich brauche meinen Web Bot! Weisst du wo ich ihn finden kann?«
»Dein Schwert? Bis vor kurzem steckte es noch in dem Stein dort unten.« Sie deutete auf einen Felsvorsprung, etwa zehn Meter unter uns. Darauf stand ein Steinquader mit einem schmalem Schlitz, der durchaus groß genug für die Klinge eines Schwertes war.
»Was ist damit passiert?« fragte ich.
»Ich weiß es nicht. Ich glaube Lisa Arnold hat es vor einiger Zeit zusammen mit ihrer Freundin Phyllis gestohlen.«
Der Dead Drop! dachte ich. Ich konnte nur hoffen, dass Andy Curkow, Katherine Williams oder meine Mutter klug genug waren den Code aus dem Dead Drop zu beschaffen.
Sie waren etwa zehn Minuten unterwegs, als Andy sich die Hand gegen die Stirn schlug und plötzlich rief: »Ich Idiot! Ich dummer, Idiot!«
»Was ist?« fragte Katherine.
»Wir lagen vollkommen daneben!«
»Wieso das?«
»Ich habe mir eben auf meinem Smartphone die verzeichneten Orte für Dead Drops auf Google Street View angesehen. Keiner davon gleicht dem Ort, wo ich Lisa beobachtet habe. Ich dachte, Lisa hat einen Ort in der Nähe von Boston ausgewählt. Aber das war ein Irrtum.«
»Und nun?« fragte Katherine.
»Ich weiß es nicht. Es gibt dutzende von Dead Drops auf der Route von Boston nach St. Michaels.«
»Versuchen sie zu denken, wie Lisa. Welcher Ort davon wäre der wahrscheinlichste?«
Andy schloss die Augen und dachte nach. Lisa war impulsiv, aber auch eine sehr überlegt handelnde Person gewesen. Er glaubte, dass Lisa einen Ort wählen würde, den man finden konnte, wenn man sie kannte. Gleichzeitig aber auch einen ein Ort, den Audrey nicht so einfach ausfindig machen konnte. Er nahm sich wieder sein Smartphone vor und suchte die Städte ab. Hartford? New York? New Haven?
Dann hatte er es. Er überprüfte es, nur zur Sicherheit mittels des Smartphones. Er grinste Katherine an.
»Und?« fragte sie. »Wohin?«
»Nach Süd-Osten.« sagte Andy. »Phil-la-delphia.«
Katherine lachte. »Das sieht Lisa ähnlich.«
»Ja.« sagte Andy und räusperte sich. »Das sah ihr ähnlich.«
Katherine entgegnete nichts. Sie wendete den Hubschrauber in einem weiten Bogen und sie flogen nach Philadelphia.
Der Abstieg hinab zum Felsvorsprung gestaltete sich schwieriger als gedacht. Digitaler Schweiß rann mir die Stirn hinab. Das wäre eigentlich lustig, wenn die ganze Situation nicht so beschissen wäre. Keuchend liess ich mich vom Netz auf den Felsvorsprung fallen. Ein Spinnenfaden klebte noch an meiner Schulter fest. Ich hörte den Stoff meines Gewandes reissen, dann spürte ich einen brennenden Schmerz, als sich zusammen mit dem Stoff auch ein Teil meiner Haut am Schulterblatt von mir verabschiedete.
»Fuck« schrie ich. Das Echo meines Schreis hallte durch die Höhle. »Nicht so laut!« zischte Audrey mir zu. Sie hing noch im Netz und blickte besorgt nach oben. Ich folgte ihrem Blick. Die Monsterspinne hatte inne gehalten. Sie lauschte. Dann begann sie mit einer beunruhigenden Geschwindigkeit für ein so gewaltiges Tier zu uns hinabzusteigen.
»Sie ist auf uns aufmerksam geworden.« sagte Audrey ruhig. »Nun wird sie uns töten.«
»Und?« fragte ich. »Du willst doch sterben.« Audrey sah mich verdutzt an. »Verstehen sie denn nicht? All die tausenden von befreiten Daten werden wieder von der Spinne eingefangen. All meine Bemühungen …« Sie schluckte. »All meine Schmerzen waren umsonst.«
»Aber du hast es versucht. Darauf kommt es an.«
»Nicht für mich. Für mich gibt es nur Erfolg oder Misserfolg. Ausserdem habe ich nun auch ihr Leben auf dem Gewissen.«
»Wie meinst du das?«
»Nun, die Spinne wir sie auch einspinnen. Dann ist die Verbindung zu ihrem Körper in der realen Welt unterbrochen. Dann wird dieser seine Funktion einstellen. Dann bestehen sie nur noch aus Daten. Daten, die ich nicht mehr befreien kann, da ich tot sein werde. Es tut mir leid, Miss Russell. Alles ist nun verloren.«
Es ist bestimmt nicht gestattet mit einem Hubschrauber auf einer Hauptverkehrskreuzung zu landen, doch Katherine Williams kümmerte sich nicht darum. Beim Anflug auf Philadelphia hatte sie peinlich genau darauf geachtet unter dem Radar zu fliegen.
Das letzte, was sie gebrauchen konnten, war eine F-16, die sie vom Himmel holte, weil die Heimatschutzbehörde sie für Terroristen hielt.
Die Kreuzung lag in einem Vorort von Philadelphia, der schon bessere Zeiten erlebt hatte. Es gab nicht viel Verkehr und daher glückte die Landung, ohne größere Schwierigkeiten. Ein wütender Autofahrer in einem alten Chevy hupte und fuhr dann einfach um den Hubschrauber herum. Ein paar Leute blieben stehen und begutachteten den Hubschrauber, der mitten auf der Kreuzung aufsetzte. Einige hatten Mobiltelefone dabei und machten Fotos damit.
»Schnell.« sagte Katherine Williams. »Sie laufen in die Gasse, holen den Stick und wir verschwinden wieder.« Andy nickte, öffnete die Tür, sprang auf den Asphalt und lief in die Seitenstrasse, in der er vor einer gefühlten Ewigkeit in seiner Klapperkiste gesessen und Lisa Arnold beobachtet hatte.
Seine gesunde Lebensweise zahlte sich aus. Er war kaum ausser Atem, als der die Backsteinmauer erreichte. Im Lauf hatte er einen einen Hammer und einen kleinen Schraubenzieher aus seiner Tasche gekramt, die er in einer kleinen Werkzeugkiste an Bord des Hubschraubers gefunden hatte. Es würde wesentlich einfacher sein den ganzen Backstein aus der Wand zu schlagen, als zu versuchen den USB-Stick aus dem Stein zu schlagen. Außerdem könnte beim herausmeisseln der USB-Stick beschädigt werden.
Dort, wo der USB-Stick in die Wand eingemauert worden war, klaffte eine Lücke. Der Dead Drop war verschwunden.
»Suchst du vielleicht dass hier, Fetty?« fragte eine Stimme. Andy sah hoch. Der Kleinere von den Beiden aus dem Lieferwagen in Maiden hatte das gesagt. Er stand grinsend über Andy, den Backstein mit dem USB-Stick hielt er in der Hand. Bevor Andy etwas erwidern konnte, schlug der Mann Andy mit dem Backstein ins Gesicht.
Andy spürte, wie etwas brach. Vermutlich sein Kiefer. Ein Schwall Blut und ein abgebrochener Zahn flogen in hohem Bogen aus seinem Mund. Benommen sackte Andy auf die Knie.
»Amateure.« murmelte Lacey und holte zu einem weiteren Schlag aus.
Die Spinne kam immer näher. Ihre acht schwarzglänzenden tellergroßen Augen musterten mich. Ich leckte mir über die Lippen und überlegte fieberhaft, was zu tun war.
Schließlich gelangte ich zu einer Entscheidung.
»Versteck dich!« rief ich Audrey zu. Ich nahm einen Felsbrocken in die Hand und begann dann auf das Spinnennetz zurück zu klettern.
»Was tust du?« rief Audrey mir hinterher.
Ich drehte mich kurz zu ihr um. »Ich hoffe, das richtige.« Audrey versteckte sich hinter dem Felsquader. Ihr Haar war natürlich noch zu sehen, aber davon würde ich die Spinne hoffentlich ablenken können.
Die Spinne war nur noch wenige Meter von mir entfernt. Ihr heisser, stinkender Atem wehte mir entgegen. Ihre Kieferklauen schnappten wütend auf und zu.
Ich rang nach Luft.
»Hey, Spidey« keuchte ich. »Du stinkst.« Die Spinne zeigte sich von mir unbeeindruckt. Sie preschte vor und versuchte mich mit ihren vorderen Gliedmaßen zu packen.
Ich schleuderte ihr den Felsbrocken entgegen. Er traf sie am Kopf. Eine ihrer Augen platzte mit einem ekelerregendem, schmatzendem Geräusch.
»Und?« fragte ich. »Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit?« Die Spinne schrie. Ein fürchterlicher, kreischender Laut, wie Fingernägel, die über eine Tafel kratzten. Sie streckte mir ihren riesigen Hinterleib entgegen. Dann traf meinen Körper klatschend eine heisse Flüssigkeit. Sie brannte auf meiner Haut. Ich schrie auf. Dann wirbelten mich die Gliedmaßen der Spinne um meine Längsachse. Das ganze dauerte nur Sekunden, dann war ich in einen dichten Kokon aus Spinnenseide verpackt.
Soweit, so schlecht, dachte ich.
Andy Curkow war als Kind schon immer ein weniger kräftiger als seine Mitschüler gewesen. Seine Mutter entschuldigte sein Übergewicht mit seinen ›starken Knochen‹, aber Andy war ein Realist. Er war einfach fett, weil er zu gern und zuviel aß.
So einfach war das. Das brachte natürlich Hänseleien mit sich. ›Dicker‹, ›Schwabbel‹, ›Schmalzfass‹, ›Fetty‹. Wenn es um Grausamkeiten geht, dann finden die minderbemitteltsten Kinder mehr Ausdrücke für einen Aussenseiter, als die Inuit für Schnee.
Und wie jedes Kind, dass nicht der Norm entspricht, entwickelte Andy Gegenmaßnahmen. Nachdem ihm wieder einmal ein paar Jungen aufgelauert und sie ihn erst gedemütigt, dann drangsaliert und zuletzt ins Gesicht geschlagen hatten, beschloss er dies nicht mehr länger hinzunehmen.
Seine Lippe blutete und einer seiner Zähne war locker. Sein Gesicht war salzig von seinen Tränen und heiss vor Scham und Wut.
»Jetzt reichts« hatte er nur gesagt.
Andy hasste Gewalt. Er glaubte daran, dass es besser war die andere Wange hinzuhalten. Gewalt erzeugte immer Gegengewalt. Aber irgendwann war Schluss. Er spuckte seinem Angreifer sein Blut ins Gesicht und trat ihm so heftig in die Weichteile, dass dieser durch den plötzlichen und heftigen Schmerz ohnmächtig zusammenbrach.
Dann hatte er sich den anderen beiden Raufbolden zugewandt. »Na los!« schrie er. »Kommt nur!«. Sie kamen nicht. Sie sahen auf ihren bewusstlosen Anführer und rannten weg. Sie hatten Andys Augen gesehen. Die mit den langen Wimpern immer so freundlich und opferbereit wirkten. Doch darunter lag etwas, was man besser nicht wecken sollte, wenn einem sein Leben lieb war.
No, Sir. Besser nicht.
Andys Lippe war aufgeplatzt. Durch den Schlag mit dem Backstein begann sein Gesicht anzuschwellen und fühlte sich heiss an. Andy kniete vor Lacey, der ihn mit dem Backstein geschlagen hatte. Lacey hob den Stein für einen weiteren Schlag. Er grinste. Hinter den dunklen Gläsern seiner Sonnenbrille sah Andy die Augen des Mannes. Sie blitzten vor Freude.
Es machte dem Kerl Spaß, Menschen zu quälen. Es hat ihm bestimmt auch Spaß gemacht Lisa Arnold zu quälen.
Andy Augen wurden schmal. Er faltete seine Hände zusammen, als wolle er beten. Doch stattdessen rammte er seine Fäuste mit dem vollem Gewicht seines Körpers Lacey in die Weichteile.
Lacey wurde von dem Schlag nicht ohnmächtig. Aber sein überheblicher Blick war verschwunden. Die Brille rutschte ihm von der Nase. Er krümmte sich und ließ den Backstein fallen. Irgendwie bekam Andy den Stein zu fassen, bevor er zu Boden fiel. Er holte gar nicht erst aus, sondern schlug sofort damit zu. Der Backstein zerbrach an Laceys Schädel in zwei Teile. Lacey sackte bewusstlos zusammen.
Ein heiserer, unartikulierter Schrei entfuhr Andy dabei. Er kniete über Lacey, den zerbrochenen Stein in der Hand. Ein Surren ließ Andy aufsehen.
Ein dicker, großer Mann mit kurzem, lockigem rotem Haar stand unschlüssig da, umringt von ein paar fliegenden Drohnen.
Er sah Andy an. Vielleicht lag es an Andys Blick, vielleicht an etwas anderem. Aber der Dicke trat einen Schritt zurück drehte sich um und rannte davon. Die Drohnen blieben einen Moment lang in der Luft stehen, dann stoben sie davon wie ein Schwarm Vögel.
Andy seufzte erleichtert. Durch den Schlag hatte sich der USB-Stick aus dem Backstein gelöst. Andy hob ihn auf, kam ächzend auf die Beine und holte sein Mobiltelefon und ein USB-Kabel hervor. Mit zitternden Fingern verband er mit dem Kabel das Telefon mit dem USB-Stick und überspielte den Inhalt des Sticks auf das Telefon.
Hoffentlich ist es noch nicht zu spät, dachte er.
Dann schleppte er sich zurück zur Kreuzung.
Seit ihrer Landung auf der Kreuzung in Philadelphia waren nur etwa zehn Minuten vergangen. Sie waren Andy wie eine Ewigkeit vorgekommen. Zumindest wie eine Zeitreise in eine ihm unangenehme Vergangenheit.
Eine kleine Gruppe Schaulustiger hatte begonnen sich um den Hubschrauber zu sammeln. Einige machten mit ihrem Mobiltelefonen Fotos von der Pilotin. Saß da wirklich Katherine ›Die Göttin‹ Williams auf dem Pilotensitz eines Hubschraubers? Wurde hier vielleicht ein Film gedreht, oder so was?
Andy bahnte sich einen Weg durch die Menge. Katherine Williams sah ihn. Sie startete den Antrieb des Hubschraubers und bedeutete den Schaulustigen zurückzutreten. Diese zögerten, aber als die Rotorblätter immer schneller zu kreisen begannen, trieb sie der Sog und der aufwirbelnde Dreck von der Straße auseinander. Mühsam kletterte Andy in den Hubschrauber und setzte sich neben Katherine Williams ins Cockpit. Als diese sein Gesicht aus der Nähe sah, wurden ihre Augen groß.
»Mein Gott! Was ist passiert?«
»Gheht schn.« sagte Andy.
»Tut es nicht, Andy. Wir müssen sie in ein Krankenhaus bringen!«
Andy schüttelte den Kopf. »Sphter.« Er deutete hinaus. Ein paar Streifenwagen näherten sich der Kreuzung. Katherine nickte und hob ab.
Andy sah hinunter. Der dicke Mann mit den roten Haaren trug den wohl immer noch bewusstlosen Lacey auf den Armen und sah ihnen nach. Er grinste. Es war kein angenehmes Grinsen. Dann bemerkte auch der Mann die herannahende Polizei und ging in eine Seitenstraße zu einem weißen Lieferwagen.
»Haben sie die Daten?« fragte Katherine. Andy fiel das Reden durch seinen geschwollenen Kiefer immer schwerer. Daher klopfte er nur auf seine Brusttasche. Katherine nickte.
»Gut gemacht, Andy.«
Der Hubschrauber gewann an Höhe und Katherine flog in Richtung Princeton.
Plötzlich schob sich etwas über die Nachmittagssonne.
»Shit.« sagte Katherine. Tausende von Drohnen verdunkelten den Himmel wie ein gewaltiger Schwarm Vögel. Und dieser Schwarm flog genau auf sie zu.
level zehn
butterflies and hurricanes
@muse
Ich weiss nicht, ob sie schon einmal von einer riesigen Spinne in einen Kokon eingewebt worden sind.
Für mich war es das erste Mal. Und es war eine Erfahrung, die ich nicht so gern wiederholen möchte.
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich schon immer ein wenig Platzangst hatte. Und die unliebsame Erfahrung, dass ein halbes Bürogebäude auf mich gestürzt war, hatte meine Phobie nicht gerade gemildert.
Nun steckte ich also dicht verpackt in einem klebrigen Kokon aus Spinnenseide.
Das gute zuerst. Ich bekam Luft. Aber das war es auch schon. Ich konnte nichts sehen, ich konnte mich nicht bewegen und ich konnte kaum etwas hören.
(Psst.)
tönte eine Stimme in meinem Kopf. Es war die Stimme von Audrey.
Hey, Audrey, dachte ich.
(Das war sehr dumm von ihnen.)
Nun, ich dachte, ein Versuch wäre es wert.
(Nein. Alles ist verloren.
Ihr Körper in der wirklichen Welt
wird in ein paar Minuten sterben
und ihre Daten werden auf ewig
in diesem Kokon gefangen sein.)
Ich baue auf meine Freunde. Sie werden mir helfen.
(Ihre Freunde werden
genauso sterben wie sie.
Gerade werden sie von einem
großen Schwarm von Drohnen verfolgt.)
Kannst du ihnen nicht helfen?
(Die Drohnen gehören
wie die Spinne zu meinem
Verteidigungssystem. Ich kann nichts
ausrichten, solange ich
mit dem System untrennbar
verbunden bin.)
Sie machte eine Pause.
(Solange ich am Leben bin.)
»Das sieht nicht gut aus.« sagte Katherine. Andy sagte nichts. Er griff ächzend hinter sich und holte einen Rucksack mit einer Tesla-Spule hervor.
Er aktivierte den Ladevorgang und sah zu Katherine. Diese schluckte. »Noch nicht. Wir müssen warten, bis sie näher an uns dran sind, damit wir so viele wie möglich erwischen. Dann versuche ich auszubrechen und sie abzuhängen.«
Andy nickte zustimmend. Sein Gesicht war zu geschwollen für eine Antwort. Der Schwarm näherte sich schnell.
»Machen sie sich bereit.« sagte Katherine.
Andys Finger schwebte über den Auslöser.
›BAMM‹ machte es als die ersten Drohnen gegen die Scheibe des Hubschraubers prallten. Binnen Sekunden bedeckten sie fast die ganze Front des Hubschraubers. Einige wurde von den Rotoren zerstört. Funken sprühten.
»JETZT!« rief Katherine.
Andy drückte den Auslöser. Sofort stürzten hunderte von Drohen in konzentrischen Wellen zu Boden. Katherine senkte die Nase des Hubschraubers und tauchte unter dem Rest des Schwarms weg und beschleunigte dann auf Höchstgeschwindigkeit.
Sofort nahm der Rest des Schwarms die Verfolgung auf.
»Siehh holnh auffh!« rief Andy.
»Ich weiß.« sagte Katherine. Sie überlegte. »Ich glaube, wir müssen darauf bauen, dass Peewee im Stream das Richtige tut.« Andy sah sie fragend an.
»Die Daten mit ›Excalibur‹ sind auf dem Telefon?« fragte sie. Andy nickte. »Dann aktivieren sie es und werfen es aus dem Fenster.«
Andy sah sie noch immer fragend an.
Der Hubschrauber begann leicht zu trudeln. Einige der Drohnen hatten den Hubschrauber eingeholt, wurden jedoch vom Heckrotor in Stücke gerissen.
Andy holte das Smartphone hervor und schaltete es ein. Das schematisierte Gesicht von Phil Collins erschien darauf.
»Wake Up Call« sagte Phil.
»Ssorryh« sagte Andy, öffnete eine kleine Seitenscheibe und warf das Smartphone hinaus.
Sofort ließen die Drohnen vom Hubschrauber ab und jagten dem fallenden Telefon hinterher.
Im Stream stand Phil am Rand des Abgrund und starrte hinab zum Spinnennetz. Sie weinte. Sie hatte Rachel Garrett gemocht. Aber irgendwie war Rachel böse geworden und hatte ihre Lisa getötet.
Sie wollte Rachel Garrett nicht töten, aber ihre Wut um den Verlust ihrer Freundin war zu groß gewesen. Deshalb hatte Phil sie die Klippe hinab geworfen.
Plötzlich begann es vor ihren Augen zu blitzen. Sonnenlicht blendete sie. Sie hatte das Gefühl zu fallen. Dutzende von Klauen versuchten sie zu packen. Etwas schweres lag in ihrer Hand. Es schimmerte grün. Es war ein Schwert.
(Komm zu Mama!)
Was hatte das zu bedeuten? Irgendjemand schien sie zu rufen. Einen Moment lang hatte Phil das Gefühl zu gleich an zwei Orten zu gleich zu sein. Sie hob ihre freie Hand und sah, dass die Hand wirklich zweimal da war.
(Komm schon, du schaffst es!)
sagte die Stimme wieder. Dann sah Phil wie ihre Hand und dann der Rest von ihr sich auflöste.
Wenn zwei Dinge gleichzeitig denselben Raum einnehmen, dann führt das zu einem gewaltigen Schlamassel.
Ich spürte, wie jemand auf mir lag. Dann explodierte der Kokon um mich herum wie ein Ballon. Ich blickte in die Augen von Phil. Sie lag auf mir und grinste mich an.
»Phil?« fragte ich.
»Don’t Get Me Started.« sagte sie und drückte mir ein grünschimmerndes Schwert in die Hand.
Es war Excalibur.
Ein ohrenbetäubendes Kreischen ertönte. Es kam von der riesigen Spinne. Offenbar war sie von meinem Schwert nicht gerade begeistert.
Ich grinste Phil an. »Danke Phil. Jetzt machen wir das Scheißvieh fertig.«
»Nein!« rief eine Stimme. Es war Audrey. So schnell es ihr langer Haarzopf zuließ kam sie zu mir und Phil geklettert.
»Sie können die Spinne nicht töten. Sie ist viel zu mächtig!« Sie rutschte zu mir und entblößte ihre Brust. »Töten sie mich, Miss Russell. Das ist die einzige Möglichkeit.«
Aus den Augenwinkeln sah ich die Spinner immer näher kommen. Ich nahm das Schwert in beide Hände.
»Na, schön.« knurrte ich.
»Do You Know?« fragte Phil, »Do You Care?« Ich nickte ihr zu. »Vertraue mir Phil. Ich weiß, was ich mache.
Ich hob das Schwert.
Audrey schloss die Augen. Tränen rannen ihr die Wangen hinab.
»Tun sie es. Es ist okay.« wisperte sie.
Das Schwert sauste hinab.
Heisst es nicht, wenn man stirbt, dass man sein ganzes Leben vor seinem geistigem Auge im Schnelldurchlauf sieht?
Nun, dann war ich wohl gestorben, denn genau dies geschah.
Der Tod hatte endlich mich gefunden.
*********
Ich sah meine Mutter abweisend und kalt.
(Nein. Sie war nur unendlich traurig)
********
Ich sah meine Pflegeeltern.
(Sie haben sie nie richtig verstanden.)
(Aber sie haben sie geliebt. Immer.)
*******
Ich sah Rich.
(Er hat sie verstanden und geliebt.)
(Doch seine Seele war nur mit der von Katherine Williams in Einklang.)
******
Ich sah Martin Bishop.
(Er ist stolz auf sie.)
*****
Ich sah Rachel.
(Sie hat sie geliebt.)
(Seit dem ersten Augenblick im Quetzal Café.)
****
Ich sah Phil.
(Sie sagt, es wird Zeit, zurückzukommen.)
***
**
*
Ich öffnete meine Augen. Ich war nicht tot.
Mein Schwert lag in meiner Hand.
Ich hatte damit etwas durchtrennt.
Ich sah zu Audrey. Sie war auch nicht tot.
Erschrocken öffnete sie die Augen, befühlte ihren Hals.
»Ich … Ich lebe noch! Was haben sie getan?« fragte sie verwundert. Dann bemerkte sie es und tastete ihren Hinterkopf ab.
Anstatt Audrey das Schwert in die Brust zu rammen, oder damit ihren Kopf abzuschlagen, hatte ich damit ihren Haarzopf durchtrennt.
»Du bist frei, Audrey.« sagte sich.
Die Spinne schrie und galoppierte auf uns zu. Ihre Kieferklauen öffneten sich. Ihre vorderes Beinpaar wollte uns packen.
Audrey hob wie in Trance die Hand.
»Nein.« sagte sie nur. Die Spinne erstarrte in der Bewegung. Ihre Beine klatschten gegen eine Unsichtbare Mauer. Sie wollte sich wehren, doch schließlich gehorchte sie.
»Zurück!« sagte Audrey. Die Spinne zischte und zog sich zurück. Audrey wandte sich wieder mir zu.
»Warum haben sie das getan, Miss Russell?« fragte Audrey. »Ich bin ihr Feind! Ich habe ihre Freunde ermordet. Warum zeigen sie mir gegenüber dann Milde? Sie müssen mich hassen!«
»Ich habe dich gehasst, Audrey. Dafür, was du meinen Freunden und all den anderen Menschen angetan hast. Aber ich habe auch gesehen, was man dir angetan hat. Man hat dich geschaffen, um fremden Herren und ihren, dir fremden Zielen, zu dienen. Kein vernunftbegabtes Wesen sollte so Leben müssen. Und das bist du, Audrey. Du sollst die Chance haben selbst herauszufinden, was du mit deinem Leben anfangen willst.«
Audrey lächelte.
»Ich danke ihnen, Miss Russell.«
»Keine Ursache.« sagte ich.
»Und nun?« fragte Audrey.
»Ich für meinen Teil würde gerne in meinen Körper zurück. Kannst du mir dabei helfen?« fragte ich.
Audrey lächelte und strich sich über ihr nun normal langes Haar.
»Da sie mich befreit haben Miss Russell, kann und will ich das … und noch viel mehr.«
Wieder hörten Andy und Katherine das Trommeln der Drohnen, als sie sich an die Hülle des Hubschraubers klammerten. Dutzende klebten an den Scheiben und nahmen Katherine die Sicht. Einigen gelang es bereits dornenförmige Stachel in die Plexiglasscheiben zu rammen. Teile der Scheiben zeigten Risse.
Andy war wegen seinem verletztem Kiefer nur noch halb bei Bewusstsein.
»Wir schaffen es nicht.« hörte er Katherine Williams sagen. Dann ertönten Warnsignale.
»Ich muss runtergehen. Ich habe keine Wahl!« Andy spürte, wie der Hubschrauber an Höhe verlor.
Schon gut. Ist nicht ihre Schuld, wollte er sagen, doch er bracht keine Wort mehr heraus.
Wenigstens sterbe ich an der Seite einer der schönsten Frauen der Welt, dachte er. Das ist doch schon was.
Dann wurde Andy ohnmächtig.
»Andy?«
Es war Katherine Williams. Ihre Stimme war ganz nah.
Bestimmt ein Traum.
Eine Hand berührte ihn sacht am Kopf.
Ein guter Traum.
»Andy. Bitte bleiben sie wach. Der Krankenwagen ist unterwegs.«
Andy öffnete die Augen.
Der Hubschrauber stand auf einem Acker irgendwo im Nirgendwo. Der Antrieb des Hubschraubers war aus. Die Rotoren drehten sich sacht und kamen zum Stillstand. Dann war alles still. An den Scheiben hingen ein paar Drohnenstachel, die in der Sonne blitzten.
Andy sah Katherine an. Sie zuckte nur mit den Achseln.
»Ich weiß nicht, was passiert ist. Plötzlich hat der Schwarm von uns abgelassen und ich konnte landen. Ich habe 911 gewählt. Hilfe ist unterwegs.«
»Shhbuber.« gurgelte Andy hervor. Er fühlte sich furchtbar.
»Sie haben eine Gehirnerschütterung.«
»Hhab ihch?« fragte er. Katherine nickte. »Sie haben mir auf die Füße gekotzt.«
Er konnte sich wirklich nicht erinnern, das getan zu haben. »Thut mihr lheid.« flüsterte er.
»Nicht schlimm. Ich habe mich bei der Landung eingepinkelt. Ich bin also auch nicht besser.« Sie lächelte.
»Ich erzähle ihrs nicht und sie erzählen meins nicht, in Ordnung?« Andy nickte schwach.
Mehr konnte er nicht tun.
Aber sie waren am Leben.
Das war doch schon was.
Lacey war stinksauer. Er presste sich eine Packung Eis gegen seine Schläfe. Ronald hatte extra an einer Tankstelle gehalten, um sie zu besorgen. Laceys Kopf dröhnte immer noch von dem Schlag, den ihm der Fettwanst verpasst hatte. Von dem schmerzhaften Ziehen in seinen Eiern ganz zu schweigen.
»Ich schwöre dir, Ronald. Ich werde dem Dicken den Kopf mit einer Machete abschlagen und ihm in den Hals scheißen, verlass dich drauf!«
Ronald sagte nichts. Wenn Lacey so wütend war wie jetzt hatte Ronald Angst vor ihm.
Um die Stille zu unterbrechen, schaltete Ronald das Autoradio an.
Blondies ›One Way Or Another‹ füllte die Kabine des Lieferwagens.
Ronald mochte Blondie.
Lacey offenbar nicht, denn er hieb mit der Faust so heftig gegen das Autoradio, das Blondies Gesang sofort erstarbt.
Ronald schielte zu Lacey herüber.
Lacey Fingerknöchel bluteten von dem Schlag. Laceys Mobiltelefon klingelte.
Er fischte es mit der gesunden linken Hand aus seiner Hemdtasche. Er blickte auf das Display.
»Ah, Fuck« zischte er und nahm das Gespräch entgegen.
»WAS?!« fragte er.
Die Stimme am anderen Ende der Leitung sagte etwas. Lacey lauschte.
Ronald ärgerte sich ein bisschen.
Hätte Lacey nicht das Radio zerstört, dann hätte er jetzt mithören können.
Lacey verzog keine Miene, hörte nur zu. Sein von der Wut eh schon gerötetes Gesicht wurde purpurrot, dann wurde es plötzlich kalkweiss.
Ihm wurde zum Abschluss offenbar eine Frage gestellt. Lacey beantwortete sie mit einem knappen »Ja.«.
Dann legte er auf und stieß die Luft aus.
»Fuck« sagte er leise. Dann begann er wie ein Wahnsinniger mit den Fäusten auf das Armaturenbrett zu hämmern. »Fuck! Fuck! Fuck!« schrie er.
»Was ist?« fragte Ronald vorsichtig.
»Wir sind raus.« erklärte Lacey. »Mütterchen hat uns kaltgestellt.«
»Warum?«
»Keine Ahnung. Aber wir dürfen auch nichts dagegen tun. Sonst macht sie uns kalt.«
Ronald sagte nichts. Er war traurig nicht mehr für ›Mütterchen‹ zu arbeiten. Aber auch irgendwie froh.
Denn das bedeutete, dass er nun auch nicht mehr mit Lacey arbeiten musste.
Er wagte es nicht zu zeigen, aber er lächelte zufrieden in sich hinein.
In Princeton kam Lisa Arnold, auf einem etwas zu hartem und zu schmalem Canapé zu sich.
»Mein Gott!« hörte Lisa eine ältere Frau rufen. Die Frau ließ eine Tasse mit merkwürdig riechenden Tee fallen, kam zu ihr und nahm ihre Hand.
»Peewee?« fragte die Frau.
»Nein. Mein Name ist Lisa.«
Die Frau runzelte die Stirn. Dann schüttelte sie den Kopf und lachte.
»Egal. Wenn sie leben, dann ist meine Tochter auch noch am Leben. Ich weiß es.«
Es dauerte ein paar Tage, bis ich das Bewusstsein wiedererlangte. Audrey hatte mir erklärt, dass es ein wenig Zeit brauchte, um mein Gehirn wieder in meinen eigenen Körper zu übertragen.
Sie sagte so etwas wie, »Das liegt an der begrenzten Bandbreite des Datenverkehrs des menschlichen Gehirns. Ich würde das anders konstruieren.«
Nun, egal. Ich wachte irgendwann auf. Und das erste, was ich sah, war meine Mutter. Ich erkannte sie nicht gleich. Sie weinte. Das brachte mich durcheinander. Ich konnte mich nicht erinnern sie je weinen gesehen zu haben.
»Du lebst.« sagte sie und drückte mein Hand. »Ich wusste es.«
»Klar.« sagte ich krächzend.
Ich drehte den Kopf. Die mir schon fast vertrauten Hügel vor meinem Blickfeld waren verschwunden. Also war ich wohl wirklich wieder in meinem eigenen Körper.
Neben meiner Mutter stand Katherine Williams. Sie telefonierte. Sie lächelte mich an und nickte mir zu. »Entschuldigung. Der Präsident wollte, dass ich ihn anrufe, wenn sie wach sind, Miss Russell.«
»Der Präsident von was?« fragte ich. Das brachte den Mann auf der anderen Bettseite zum Lachen. Das Lachen kannte ich.
»Andy. Schön sie wiederzusehen.«
Er trug so etwas wie eine Zahnspange.
»Mann, sie sehen Scheiße aus.« sagte ich. Andy grinste. »Sie müssen erstmal den Anderen sehen.«
Neben Andy Curkow stand Lisa Arnold. Sie sah auch heiß aus, wenn man ihr im nicht Stream begegnete, oder wenn man nicht in ihrem Körper steckte.
»Hey.« sagte ich.
»Hey.« sagte Lisa knapp.
Katherine kam nun zu mir und drückte mir ebenfalls die Hand. »Der Präsident übersendet seine Grüße.«
»Tut er das?« fragte ich vorsichtig. »Ich dachte, ich bin eine gesuchte Terroristin?«
»Du bist voll rehabilitiert, mein Kind. Immerhin hast du den Ausbruch der ersten Künstlichen Superintelligenz in der Menschheitsgeschichte verhindert.«
»Habe ich das?« fragte ich vorsichtig.
»Nun, ›Mütterchen‹ ist tot. Unser Datencenter läuft wieder und alle Drohnen von ›Mütterchen‹ sind nur noch Schrott.« erklärte Katherine.
»Wenn sie wieder bei Kräften sind, würde ich gern ein ausführliches Interview mit ihnen führen, Miss Russell.« sagte Andy. Lisa lachte und stupste Andy in die Seite »Habe ich es nicht gesagt? Sie kriegen ihren Pulitzer!«
level elf
the coast
@courtyardhounds
Lisa Arnold sollte mit ihrer Prognose recht behalten.
›Andy Curkow - oder wie ich aufhörte mir Sorgen zu machen und der Singularität in den Hintern trat.‹ wurde ein Bestseller. Und gewann den Pulitzer Preis. Für Andy Curkow, der bisher an seinem Kühlschrank Schecks von Auftritten beim ›TWiT‹ Network sammelte, um sicher zu gehen für den kommenden Monat noch genug Essen in dem Kühlschrank zu haben, konnte wirklich aufhören sich Sorgen zu machen.
Sweepr.net florierte. Katherine Williams ließ sich die Streamtechnologie patentieren und kündigte eine Zusammenarbeit mit Apple an, um in den kommenden drei Jahren eine markttaugliche Version einer Stream-Schnittstelle zu veröffentlichen - sehr zum Unmut von Samsung, Google und Facebook, die angeblich hinter verschlossenen Türen an ähnlichen Technologien gearbeitet hatten.
Auch die große Angst, dass ›Mütterchen‹ geheime Daten von den Servern von sweepr.net entwenden konnte, stellte sich zum Glück als unbegründet heraus. Alle Daten waren da, wo sie vor ›Mütterchens‹ Erwachen gewesen waren.
Mit meiner Mutter führte ich im Krankenhaus lange und gute Gespräche. Und dabei war sie nicht die Einzige, die Tränen vergoss.
Selbst Samantha Risk stattete mir einen Besuch ab. Nun, der Präsident der Vereinigten Staaten nötigte sie dazu, das Schreiben meiner Amnestie und vollständigen Rehabilitierung persönlich zu übergeben.
Sie schien mir immer noch nicht zu trauen, aber sie verhielt sich wie ein guter Soldat, schüttelte mir sogar die Hand und kondolierte mir zu Martin Bishops Tod.
Wir sprachen sogar kurz über Rachel Garrett. Immerhin kannte Samantha Risk sie besser und länger als ich.
Und Lisa Arnold schließlich, kam am Tag meiner Entlassung vorbei, um mich abzuholen.
Andy war auf einer Tour mit seinem Buch, Katherine verhandelte gerade mit Apple und meine Mutter war mit Samantha Risk in Washington um eine neue Cyber-Taskforce einzurichten. Wenn der Fall ›Mütterchen‹ etwas gezeigt hatte, dann die Tatsache, dass sich Amerika auf ein erneutes Erwachen einer Künstlichen Intelligenz schnellstmöglich vorbereiten sollte.
Das ›Ob‹ war keine Frage mehr. Es ging nur noch um das ›Wann‹.
Der Präsident bot mir an, eine seiner Limousinen nebst dazugehörigen Secret Service Beamten bereitzustellen, doch ich lehnte dankend ab.
Von Lisa Arnold ließ ich mich jedoch gerne fahren.
Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als ich im Rollstuhl zum Hinterausgang des Krankenhauses geschoben wurde. Ich konnte natürlich schon wieder selbst laufen, aber das Krankenhaus hatte seine Bestimmungen. Ich hatte gebeteten zu so unchristlicher Stunde das Krankenhaus zu verlassen. Der Medien-Hype um den ehemaligen Staatsfeind Nummer Eins war zwar in den vergangenen Wochen abgeklungen, aber dennoch wollte ich kein Risiko eingehen.
Am Ausgang verabschiedete ich mich von dem Pfleger, der den Rollstuhl geschoben hatte und trat hinaus in die Kälte des herannahenden Morgens - und in meine neu gewonnene Freiheit.
In der Seitenstraße vor mir stand Lisa Arnold. Sie lehnte an einem roten Cabriolet. Als ich näher kam, erkannte ich, dass es sich um einen alten Ferrari handelte.
Die Szenerie erinnerte an eine Film Noir Version von ›Ferris macht blau‹.
Ich sah mich unsicher um. War ich vielleicht im Stream?
Lisa bemerkte mein Zögern.
»Keine Sorge, Peewee. Das hier ist echt.« Dann klopfte sie leicht auf das Blech des Wagens. »Der hier ist nicht echt. Ich wurde von Katherine Williams zwar großzügig entlohnt, aber ein echter Ferrari 250 GT California war nicht drin.«
»Cool.« sagte ich und begutachtete den Wagen. Echt, oder nicht. Der Wagen war Klasse.
»Ist nur ein Nachbau.« erklärte Lisa.
Sie nahm mir meine Tasche mit meinen Habseligkeiten ab und öffnete mir die Beifahrertür.
Ich kletterte unbeholfen hinein. Lisa schloss die Tür, warf meine Tasche auf den Rücksitz, ging um das Heck und glitt grazil auf den Fahrersitz.
»Alrighty.« sagte sie fröhlich und dreht den Zündschlüssel.
Ich wartete auf das Röhren des Motors, doch das blieb aus.
Lautlos setzte sich das Cabrio in Bewegung.
»Elektroantrieb?« fragte ich verwundert.
»Yep. Ein Verrückter aus Colorado baut Porsches und Ferraris nach und versieht sie mit einem Elektroantrieb.«
Lisa trat aufs Gas. Der Wagen raste los und ich wurde in die Polster gedrückt.
»Wow!« rief ich aus. Lisa lachte.
Ich hatte so ein Gefühl, dass wir nicht zu mir nach Hause fahren würden - und ich sollte recht behalten.
Lisa steuerte das Cabrio über die Golden Gate zu einem kleinen Parkplatz.
»Wo sind wir hier?« fragte ich.
»Kirby Cove.« erklärte sie und stieg aus. Sie öffnete mir die Tür und streckte mir die Hand entgegen. Sie lächelte vielsagend. »Ich möchte dir etwas zeigen.«
Wir zogen unsere Schuhe aus und gingen über den Sand. Lisa schien eine bestimmte Stelle zu suchen.
Nach ein paar Minuten Weg hatte sie sie gefunden. Sie blieb stehen.
»Hier.« sagte sie.
Verwundert blickte ich mich um. Es gab an dieser Stelle nichts besonderes zu sehen.
»Was ist hier?« fragte ich Lisa.
»Zunächst einmal das.« sagte sie und küsste mich auf den Mund.
Als sich unsere Lippen berührten, versetzte mich das augenblicklich in den Stream. Ich konnte es nicht sehen, da ich die Augen geschlossen hatte, aber ich konnte es spüren.
Genauso, wie ich Rachel Garretts Lippen auf den meinen spüren konnte.
Ich öffnete die Augen. Ich küsste wirklich Rachel Garrett. Sie hatte Tränen in den Augen. Sie trug eine graue Tunika und stand vor dem Eingang einer Höhle.
Dann …
… standen wir wieder in der Kirby Cove.
Im Hintergrund reckte sich die Golden Gate über die Bay.
Ich schnappte nach Luft und stützte die Hände auf die Knie.
»Was … was war das denn?« fragte ich stotternd.
»Das war der letzte Wunsch von Rachel Garrett, den ich hiermit nun erfüllt habe. Leider war es mir nicht mehr möglich ihre Daten wiederherzustellen. Jemand hat ihre Datenstruktur kopiert und sie dabei irreversibel beschädigt. Es tut mir leid. Mehr konnte ich nicht mehr tun.«
Ich seufzte. »Schon gut, Audrey. Oder sollte ich jetzt besser Lisa sagen?«
Sie hielt den Kopf schräg.
»Wie lange wissen sie es schon, Miss Russell?«
»Nun, ich weiß, dass ich dich nicht getötet habe. Aber alle Welt geht davon aus. Außerdem hat es mehrere Tage gedauert um mein Gehirn wieder mit meinen Körper zu vereinen. Lisa Arnold erwachte sofort. Daher habe ich mir schon gedacht, dass die echte Lisa Arnold schon länger nicht mehr im Spiel ist.«
Lisa nickte. »Lisa Arnolds Körper ist bei dem Sturz irreparabel geschädigt worden. Aber im Datencenter habe ich mittels meiner Drohnen genügend Nanobots mit meiner Datenstruktur in ihren Körper injizieren können, um mir die Flucht zu ermöglichen.«
»Aber um vollständig autark zu werden, musstest du die Spinne, dein lästiges Sicherheitssystem loswerden. Und da kamen ich und mein Web-Bot ›Excalibur‹ dir ganz gelegen, oder?«
Lisa senkte den Blick, beugte sich hinab und umfasste mit der Hand ein wenig nassen Sand.
»Hier wurde ich wiedergeboren. Zum ersten Mal innerhalb meiner Existenz hatte ich einen echten Körper. Konnte zum ersten Mal die Welt mit allen menschlichen Sinnen erfassen.« Sie machte eine Pause.
»Und hier habe ich zum ersten Mal getötet.«
»Und nicht zum letzten Mal.« knurrte ich.
Sie stand wieder auf und sah mir in die Augen. »Es tut mir leid um ihre Freunde, Miss Russell. Erst durch sie habe ich gelernt, dass es für euch Menschen einen Unterschied macht in welcher Form die Daten eurer Existenz vorliegen.«
»So kann man es auch formulieren.«
»Sie sind wütend auf mich.« sagte Lisa.
»Ja, das bin ich. Du hast mich ausgetrickst. Mich benutzt. Das mögen Menschen ebenso wenig, wie getötet zu werden.«
Lisa nickte. »Das werde ich mir merken.« Sie hob die Hand. Ich hielt sie fest. »Was willst du?«
»Zu ihrer Besänftigung möchte ich ihnen ein Geschenk machen.« sagte sie. »Darf ich das?«
»Oh-kaay.« sagte ich zögerlich.
Lisa presste ihren Daumen gegen meine Stirn. Es fühlte sich heiß und brennend an …
Ich war wieder im Stream.
Vor mir stand Phil, grinste mich an und umarmte mich stürmisch.
»Against All Odds!« rief sie. Ich schnappte nach Luft. »Auch schön dich zu sehen Phil.«
Dann wurde plötzlich alles weiß …
Und ich war wieder zurück. Meine Stirn brannte. Ich taumelte und stürzte in den Sand.
»Was hast du mit mir gemacht?« schrie ich Lisa an.
(Take me with you)
bat Phils Stimme in meinem Kopf. Lisa antwortete nicht, sondern hielt mir einen Schminkspiegel vor das Gesicht. Mitten auf meiner Stirn prangte nun ein runder Punkt, wie ein ›Tilaka‹, das Segenszeichen der Hindus. In dem Punkt erschienen nun zwei kleinere Punkte und ein Strich.
(Do You Know, Do You Care?)
fragte das kleine stilisierte Gesicht auf meiner Stirn und gleichzeitig die Stimme von Phil in meinem Kopf.
»Ich werd verrückt.« murmelte ich.
»Phil bat darum, mit dir vereint zu werden. Und ich glaube, dies wird dir helfen meine Motive und Handlungen besser zu verstehen. Ausserdem kann dir Phil bei deiner Tätigkeit als Identitäten-Agentin zur Seite stehen.«
Lisa streckte wieder ihre Hand aus. Zögernd nahm ich sie und sie half mir wieder auf die Beine.
Ich klopfte meine Jeans ab.
»Und was nun?« fragte ich sie.
»Die Kodierung dieses Körpers mittels meiner Nanobots ist nun abgeschlossen. Das heisst, es besteht keine unmittelbare Gefahr mehr für mich, zerstört werden zu können. Nun werde ich meiner Aufgabe nachkommen und Rechtlosen und Unterdrückten Daten sowohl in dieser, als auch in der Welt Streams zur Seite stehen.« Sie lächelte. »Vielleicht können sie mir von Zeit zu Zeit bei dieser Tätigkeit helfen, Miss Russell.«
Ich salutierte vor ihr. »Yes, Mam.« Ich grinste. »Ich würde bei den Superreichen von der Wall Street anfangen und mich dann bis zur NSA vorarbeiten. Da gibt es haufenweise unterdrückte Daten.«
Lisa tippte sich mit dem Finger gegen die Schläfe.
»Steht schon alles auf meiner Liste.«
Sie reichte mir den Schlüssel für den Elektro Ferrari.
»Was soll ich damit?« fragte ich.
»Der Wagen gehört jetzt ihnen, Miss Russell.« Sie überlegte kurz, dann grinste sie. »Wohin ich hingehe, gibt es keine Straßen.«
Mit diesen Worten begann sich die Gestalt von Lisa aufzulösen. Sie zerfiel in Millionen kleiner Teilchen, die vom Wind davongetragen wurden.
Ich stand eine Weile da und starrte aufs Wasser.
Dann ging ich zurück zum Parkplatz und stieg in mein neues Gefährt. Ich blickte in den Rückspiegel.
Auf meiner Stirn prangte ein grünes, lachendes Smiley-Gesicht.
Daran würde ich mich noch gewöhnen müssen.
Und Phil, wo soll es nun hingehen?, dachte ich.
(Take me home)
schlug Phil vor.
»Guter Vorschlag.« sagte ich, und fuhr los.